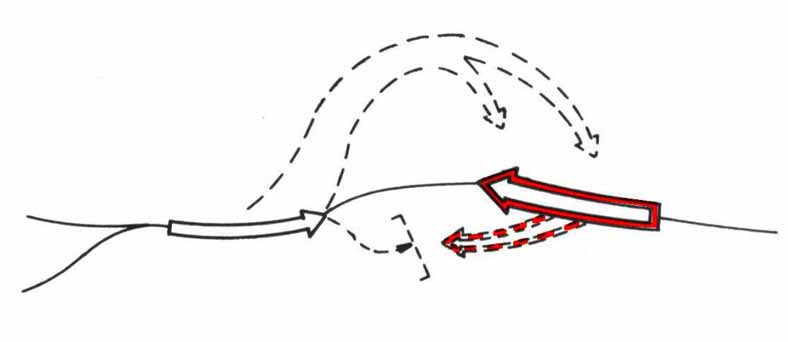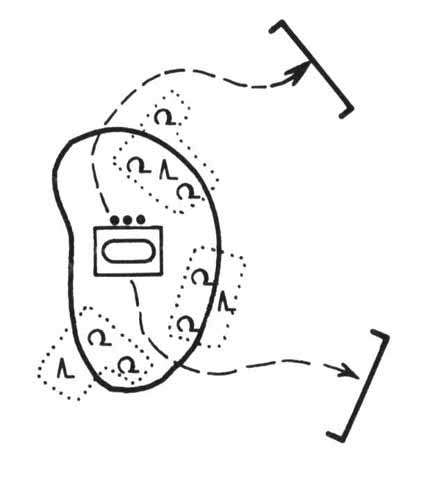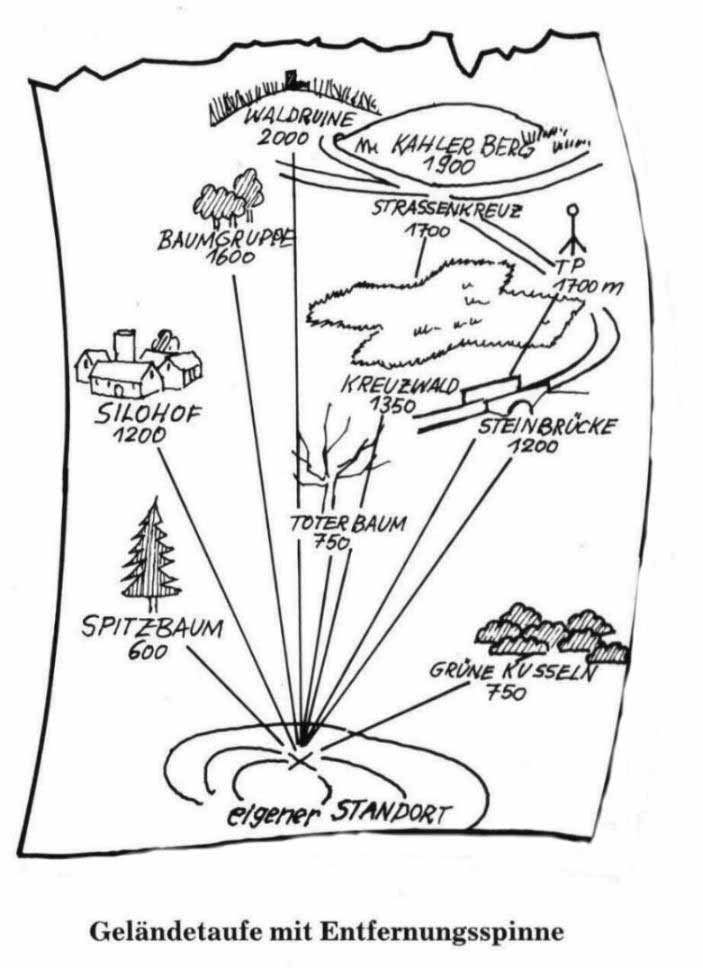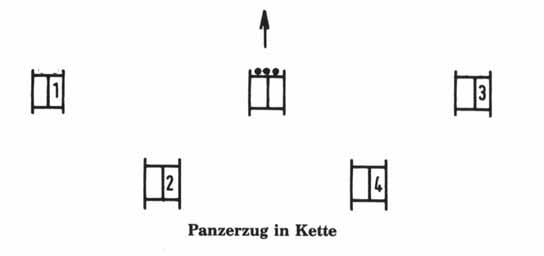Taktische
Grundbegriffe
Erstaunlicherweise gab es bei der Wehrmacht keine, in einer Vorschrift
zusammengefaßte Definition von Führungsbegriffen, wie sie z.B. bei der
Bundeswehr mit der HDv 100/900 „Führungsbegriffe“ existiert. Für den
Bereich der Wehrmacht müssen diese Fachwörter aus einer Vielzahl von
Dienstvorschriften und anderen amtlichen Druckschriften zusammengetragen werden;
bei einer ganzen Reihe davon ergibt sich die Verwendung eines bestimmten
Begriffes nur aus dem allgemein in der Wehrmacht gebräuchlichen Sprachgebrauch,
wie er z.B. in taktischen Handbüchern oder auch in schriftlich erhaltenen
Befehlen nachvollziehbar ist.
In den folgenden Skizzen wurden die heute bei der Bundeswehr gebräuchlichen
taktischen Zeichen verwendet, da diese allgemein bekannt sind und eine übersichtlichere
Darstellung als die Zeichen der Wehrmacht erlauben.
Abholpunkt
1. Stelle im Gelände, von dem Versorgungsgüter durch die
Truppe abgeholt werden können.
2. Punkt für die Übernahme und Weiterführung einer oder mehrerer
Fernmeldeleitungen.
Ablauflinie (AL)
Quer zur Angriffsrichtung festgelegte Führungslinie, mit deren Überschreiten
der Angriff beginnt. Durch die Ablauflinie werden die Bewegungen der
angreifenden Kräfte untereinander und mit dem Feuer der unterstützenden Waffen
zeitlich und räumlich in Einklang gebracht.
Ihr Verlauf muß im Gelände klar zu erkennen sein.
à Führungslinien

Ablaufoffizier
Offizier oder in kleineren Verhältnissen auch Unteroffizier, der dafür sorgt,
daß die Marschkolonne den Ablaufpunkt zur befohlenen Ablaufzeit unter
Einhaltung der befohlenen Marschfolge und – abstände überschreitet. Für
seine überwachende Tätigkeit sind ihm ggf. Hilfskräfte, insbesondere
Kradmelder zuzuteilen; er hat die Verkehrsregelung am Ablaufpunkt
sicherzustellen.
Ablaufpunkt
Punkt auf einer Marschstraße, der zu einer bestimmten Zeit (Ablaufzeit) zu überschreiten
ist.
Spätestens dort müssen die Teile einer marschierenden Truppe zu einer
Marschkolonne oder zu Marschgruppen zusammengeführt und in die Marschbewegung
eingegliedert sein.
Der Ablaufpunkt soll in Marschrichtung so liegen, daß die Teile der Truppe sich
auf dem Anmarsch zum Ablaufpunkt nicht gegenseitig behindern und den Ablaufpunkt
zügig überschreiten können. Ablaufpunkte unmittelbar vor oder hinter
Ortsdurchfahrten, an starken Steigungen, an Engstellen oder Brücken sind
ungeeignet.
Ablaufzeit
Zeitpunkt, zu dem das vorderste Fahrzeug einer Marschkolonne usw. den
Ablaufpunkt zu überschreiten hat.
Ablösung
Operation mit dem Ziel, Truppen oder einzelne Soldaten durch andere zu ersetzen.
Die Ablösung erfolgt in der Stellung oder im Rahmen der Aufnahme, seltener
durch Angriff.
Ablösung ist ein Schwächemoment und bedarf präziser Planung, eingehender
Absprachen / Einweisung und
straffer Führung. Während der Ablösung muß der Gefechtsauftrag ohne Einschränkungen
durchgeführt werden.
Verbindungsaufnahme und Erkundung – wenn möglich – bei Tage; Durchführung
der Ablösung bei Nacht oder schlechter Sicht.
Während der Ablösung Lichtdisziplin, An- und Abmarsch über getrennte Straßen
– dazu Einsatz der Feldgendarmerie/Verkehrsregelungseinheiten.
Verantwortlich für die Gefechtsführung: Bis zum Abschluß der Ablösung der Führer
des abzulösenden („alten“) Verbandes, der sich dazu die ablösende
(„neue“) Truppe bei Bedarf unterstellt.
à Aufnahme
abriegeln
1. Allgemein
Feind durch Feuer, Sperren oder Truppen daran hindern, einen bestimmten Geländeteil
zu überwinden.
2. Feuerauftrag/Feueranforderung
Angreifenden oder zurückgehenden Feind für eine begrenzte Zeit zum Stehen
bringen oder daran hindern, einen bestimmten Geländeteil zu durchschreiten.
Absitzraum
Raum, in dem infanteristische Kräfte vom Kraftfahrzeug absitzen, um Bewegungen
oder den Kampf zu Fuß aufzunehmen. Der Absitzraum kann gleichzeitig Abstellraum
für die Kraftfahrzeuge sein.
Abstand
Entfernung zwischen Personen, Fahrzeugen sowie zwischen Truppen nach vorn und
hinten, gemessen in Längen- oder Zeiteinheiten.
à Fahrzeugabstand
à Marschabstand
à Zwischenraum
Abwehr
à Verteidigung
Alarmeinheiten
In Krisensituationen durch Zusammenfassung örtlicher vorhandener Kräfte ohne Rücksicht
auf deren ursprüngliche Truppenzugehörigkeit gebildete Einheiten.
Alarmplatz
Platz, auf dem sich bei Alarm alle Soldaten, denen nicht die Besetzung
bestimmter Alarmstellungen oder die Aufrechterhaltung der Arbeitbereitschaft
befohlen ist, sammeln, um von dort aus eingesetzt zu werden.
Alarmstellung
Vorbereitete Stellung, die eine Truppe bei Alarm bezieht, um einen feindlichen
Angriff abwehren zu können. Alarmstellungen sind in jeder Lage und bei jeder
Truppe vorzubereiten.
Alarmtruppe
In Bereitstellungs- oder Ruheräumen und in rückwärtigen Gebieten ständig
einsatzbereit gehaltene Kräfte, um überraschend auftretenden Feind zu bekämpfen.
Die Alarmtruppe hat auf Bataillonsebene meist die Stärke eines verstärkten
Zuges, bei der Sicherung rückwärtiger Gebiete ist er nach Möglichkeit auf
Kraftfahrzeugen beweglich zu machen.
allgemeiner Feuerkampf
Art des Feuerkampfes der Artillerie.
Durch den allgemeinen Feuerkampf nimmt der Truppenführer Einfluß auf das
Gefecht mit dem Ziel, Truppen, schwere Waffen, Einrichtungen und Anlagen des
Feindes zu bekämpfen, die den Großverband als Ganzes bedrohen oder ihn
hindern, seinen Auftrag auszuführen.
Diese Ziele stehen oft nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Gefecht
einzelner Verbände der Kampftruppen und können von diesen meist nicht aufgeklärt
und bekämpft werden.
Träger des allgemeinen Feuerkampfes ist meistens die mit weitreichenden Geschützen
ausgestattete schwere Artillerie sowie die Eisenbahnartillerie.
à unmittelbare Feuerunterstützung
Angliederung
Der Begriff „Angliederung“ kann zur Bezeichnung einer Unterstellung in
Verbindung mit Worten wie „verwaltungsmäßig“ oder „ärztlich“
gebraucht werden, wenn ein selbständiges Kommando oder dergleichen keine eigene
Verwaltung, Arzt usw. erhält, sondern dazu einer anderen Einheit angeschlossen
wird.
Angriff
Gefechtsart, in der eine Truppe unter Raumgewinn Feindkräfte zerschlägt oder
zurückwirft.
Der Angriff wirkt durch Bewegung, Feuer und die Richtung, in der er geführt
wird.
Er soll meist die Entscheidung des Gefechts herbeiführen. In manchen Lagen
dient er nur dazu, ein bestimmtes Gelände in Besitz zu nehmen, aufzuklären,
den Feind zu täuschen oder im Kampf stehende eigene Truppen zu entlasten oder
abzulösen.
Breiten im Angriff:
Infanteriebataillon, beiderseits angelehnt: 400 bis 1.000 m
Infanteriedivision im Begegnungsgefecht: 4.000 bis 5.000 m
Infanteriedivision, im Schwerpunkt eingesetzt: nicht mehr als 3.000 m
Angriffsachse
Führungslinie, die angreifenden Kräften den Weg zum Angriffsziel in groben Zügen
vorschreibt. Die Angriffsachse wird entsprechend der beabsichtigen
Angriffsrichtung unter Anpassung an das für die Bewegung geeignete Gelände
festgelegt.
Angriffsziel
Geländeraum, den eine Truppe im Angriff zu nehmen hat. Das Angriffsziel muß
deutlich zu bezeichnen sein und der Truppe so viel Raum geben, daß keine
Zusammenballung entsteht.
à Zwischenziel
Anmarsch
1. Vorgehen von Angriffskräften bis zur Ablauflinie.
2. Bewegungen eines Marsches vom Aufkommensort zum Ablaufpunkt, beispielsweise
der Marsch einzelner Kompanien von ihren Unterkünften bis zum Beginn der
Marschstraße.
Annäherung
Im Angriff die Phase von Angriffsbeginn bis zum Einbruch. Gegen tiefgestaffelten
Feind können sich Annäherung und Einbruch mehrmals wiederholen.
Anschlußkommando
Verbindungsorgan, das auf dem Marsch die Verbindung zur vorausmarschierenden
Truppe hält und das Einhalten des befohlenen Marschabstandes überwacht, um ein
Auflaufen oder Abreißen zu verhindern. Anschlußkommandos sind von der Einheit
aufwärts einzuteilen.
à Marsch, Marschabstand
Anschlußpunkt
Stelle im Gelände, an der benachbarte Truppen miteinander Verbindung herstellen
und diese so lange halten, wie es die Operation erfordert.
Anschlußpunkte liegen häufig an Schnittpunkten von Grenzen mit anderen Führungslinien.
Anschlußpunkte sollen nach Möglichkeit über Fernmeldeverbindungen verfügen.
Anweisung auf Zusammenarbeit
Regelung des Zusammenwirkens von Truppen oder Personen, die in keinem
Unterstellungsverhältnis zueinander stehen.
Verpflichtet zu gegenseitiger Unterrichtung, Beratung und Unterstützung bei
einer gemeinsamen Aufgabe. Der auf Zusammenarbeit angewiesene bleibt seinem Führer
nach Grundgliederung unterstellt und erhält von diesem den Auftrag. Er ist
verpflichtet, die Forderung des anderen zu erfüllen, soweit es sein Auftrag zuläßt.
Arbeitsbereitschaft
Zustand, in dem eine Einrichtung oder ein Stab nach Abschluß aller
Vorbereitungen, einschließlich der Sicherung die Arbeit aufnehmen kann.
Artilleriebekämpfung
Teil des Feuerkampfes der Artillerie, bei dem feindliche Geschütze,
Granatwerfer, Raketenwerfer, Panzerabwehr- und Flugabwehrgeschütze in Stellung
bekämpft werden.
Zur Zielortung sind meist technische Aufklärungsmittel notwendig.
Artillerieführer
Bezeichnung für einen Führer der Artillerietruppe, der seinen Truppenführer
in artilleristischen Fragen berät.
Der Artillerieführer ist für die einheitliche Vorbereitung und Führung des
Feuerkampfes der gesamten Artillerie, die dem Truppenführer untersteht, und für
die artilleristische Aufklärung verantwortlich. Auf Weisung seines Truppenführers
kann er auch der Artillerie unterstellter Großverbände Feueraufträge
erteilen.
Artillerieführer der Division ist der Kommandeur des
Divisionsartillerieregiments, Artillerieführer des Korps der
Artilleriekommandeur (ArKo) oder der Regimentskommandeur eines zugeteilten
Artillerie-Regimentsstabes z.b.V.; Artillerieführer der Armee meistens eine Höherer
Artilleriekommandeur (Harko).
Artilleriewetterdienst
Kräfte der Aufklärenden Artillerie, die Wetterdaten für die Schießende und
die Aufklärende Artillerie ermitteln und auswerten.
Auffangminensperre
Mit oder ohne Schema, offen oder verdeckt angelegte Minensperre.
Die Auffangminensperre soll das Vordringen des Feindes verlangsamen und seinen
Angriff möglichst zum Stehen bringen oder in bestimmte Richtungen lenken. Sie
ist zu verteidigen, mindestens aber zu sichern oder mit beobachtetem Feuer zu überwachen.
Ihre Lage muß auf die Operationen der Kampftruppe abgestimmt sein.
Aufgabentabelle
Besondere, für begrenzte Zeit gültige Form des Feuerplans. Die Aufgabentabelle
legt folgende Einzelheiten fest:
-schießende Truppenteile
-Zeit der Bekämpfung
-zugewiesene Ziele
-Munitionseinsatz
Aufklärung
Sammelbegriff für alle Maßnahmen, die dazu dienen, durch militärische Kräfte
Informationen vor allem über den Feind zu gewinnen.
à Aufklärung, artilleristische
à Aufklärungstiefe
à Eindringtiefe
à Erkundung
à Flugabwehraufklärung
à Gefechtsaufklärung
à Luftaufklärung
à Nachrichtenaufklärung
Aufklärung, artilleristische
Mit Mitteln der Artillerie betriebene Aufklärung als Voraussetzung für die Führung
des Feuerkampfes.
Die artilleristische Aufklärung dient dazu
-das Gefechtsfeld zu überwachen,
-Ziele zu entdecken und zu bestimmen
-das Feuer eigener Waffen zu lenken und den Erfolg des Wirkungsschießen
festzustellen.
-die eigenen Aufklärungsergebnisse und solche anderer Truppen auszuwerten und
zu melden.
Kräfte der art. Aufklärung sind die Vorgeschobenen Beobachter der Artillerie
und die Einheiten der Beobachtenden Artillerie (Beobachtungsabteilungen und
–Batterien) sowie in Einzelfällen eigens für Zwecke der Artillerie
eingesetzte Aufklärungsfliegerkräfte.
Aufklärungsmittel
Geräte und Systeme, durch deren Einsatz Aufklärungsergebnisse und
Informationen gewonnen werden. Zu den Aufklärungsmitteln gehören:
-optische Meßinstrumente
-Geräte zur Schall- und Lichtmessung
-Luftbildsysteme
-Geräte der Fernmeldeaufklärung
-Radargeräte / Funkmeß
Aufklärungsziel
Feindkräfte, Geländeteile, Anlagen, Einrichtungen, Waffen und Gerät sowie
Sachverhalte, gegen die sich die Aufklärung richtet.
Wichtige Aufklärungsziele sind Truppenansammlungen, Feuerstellungen schwerer
Waffen, Gefechtsstände, Fernmeldezentralen, Einrichtungen der Luftwaffe,
Feldbefestigungen, Sperren und Versorgungseinrichtungen des Feindes. Auch die
Feststellung, wo sich feindfreies Gelände befindet, kann Ziel der Aufklärung
sein.
Aufmarsch
Bewegungen von Truppen in die für den Kriegsfall vorgesehenen Einsatzräume
sowie Einrichten der Versorgungseinrichtungen.
Aufnahme
Operation, bei der eine Truppe aus Stellungen das Ausweichen anderer Kräfte überwacht
und nachdrängenden Feind so lange aufhält, bis die aufzunehmenden Truppen
durch die Stellung geschleust oder in dieser abwehrbereit sind.

Aufnahmebereitschaft
Zustand, in dem eine Sanitätseinrichtung Verwundete aufnehmen, behandeln und
pflegen kann.
Aufnahmelinie (ANL)
Führungslinie bei der Aufnahme, nach deren Überschreiten durch die
ausweichende Truppe der Führer der Aufnahmetruppe für die Operationsführung
verantwortlich ist.
Aufnahmestellung
Stellung, in der eine Truppe eingesetzt ist, um ausweichende Truppen
aufzunehmen.
Aufnahmetruppen
Kräfte, die Auftrag haben, andere Truppen aufzunehmen.
Auftrag
Der Teil jedes Befehls, der das Ziel setzt.
Auftragstaktik
à Führen mit Auftrag
Ausbruch
Operation von Kräften mit dem Ziel, sich aus einer Einschließung zu befreien.
Auslaufpunkt
Befohlener Punkt auf einem Marschweg, der das Ende einer Marschstraße angibt,
er ist zu einer bestimmten Zeit zu überschreiten.
Vom Auslaufpunkt erreichen die Teile einer Marschkolonne ihre
Marschziele/Einsatzräume selbständig.
Der Auslaufpunkt soll so liegen, daß die Truppen ihn zügig überschreiten können
und sich auf dem Weitermarsch nicht gegenseitig behindern. Am Auslaufpunkt enden
im allgemeinen die für den Marsch befohlenen Unterstellungen.
Auslaufzeit
Zeitpunkt, zu dem das letzte Fahrzeug einer Marschkolonne dem Auslaufpunkt zu
durchfahren hat.
ausschalten
Feuerauftrag/Feueranforderung: Dem Feind an bestimmten Stellen für eine
begrenzte Zeit durch Nebel- und Brisanzfeuer die Möglichkeit der Beobachtung
und der Waffenwirkung zu nehmen.
ausweichen
Operation, bei der ein im Gefecht stehende Truppe Abstand vom Feind gewinnen
soll, um anderweitig eingesetzt zu werden.
Ausweichfrequenz
Frequenz, die einer bestimmten Funkverkehrsbeziehung für den Fall zugeteilt
ist, in dem die Arbeitsfrequenz nicht verwendet werden kann.
Befehl
Anweisung zu einem bestimmten Verhalten, die ein militärischer Vorgesetzter
einem Untergebenen schriftlich, mündlich oder in anderer Weise allgemein oder für
den Einzelfall mit dem Anspruch auf Gehorsam erteilt.
Befehlshaber
1. Truppenführer oberhalb der Korpsebene
2. Bezeichnung für einen Truppenführer nach besonderer Festlegung (z.B.
Befehlshaber im Wehrkreis, Wehrmachtbefehlshaber)
Befehlsstelle, bewegliche
Einrichtung mit Personal und möglichst Kraftfahrzeugen, mit deren Hilfe ein Führer
für begrenzte Zeit außerhalb seines Gefechtsstandes führen kann, wenn er am
Brennpunkt des Geschehens persönlichen Einfluß auf die Operation nehmen will.
Die bewegliche Befehlsstelle wird aus Personal und Material des jeweiligen
Stabes gebildet. Durch ausreichende Ausstattung mit Fernmeldemitteln muß die Führungsfähigkeit
der beweglichen Befehlsstelle und die sichere Verbindung zum Gefechtsstand
unbedingt sichergestellt werden.
Häufig wurde statt dessen die Bezeichnung „Führungsstaffel“ verwendet.
Zusammensetzung am Beispiel einer Division:
-Divisionskommandeur mit Ordonnanzoffizier im Kübelwagen
-Artillerie- und ggf. Pionierführer im Kübelwagen
-ein bis zwei Funkwagen
-mehrere Kradmelder
-ggf. Luftwaffenverbindungsoffizier mit eigenem Funktrupp.
Begegnungsgefecht
Gefecht, das entsteht, wenn marschierende oder entfaltet vorgehende Gegner
aufeinandertreffen und den Kampf ohne Vorbereitung aufnehmen. Mit dem Entschluß
des Führers, wie er die Operation weiterführen will, geht das
Begegnungsgefecht in einer der Gefechtsarten über.
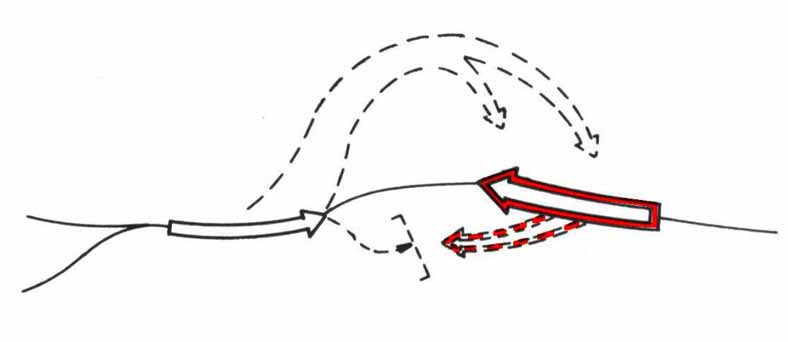
Behelfsbrücke
Brücke, die Pioniere in Behelfsbauweise aus örtlich vorhandenen, aus dem Lande
beschafften oder zugeführten Baustoffen bauen. Militärischer und ziviler
Verkehr kann sie wie ständige Brücken nutzen. Auch beschädigte ständige Brücken
lassen sich so wieder herstellen.
Der Bau von Behelfsbrücken ist meistens durch hohen Materialverbrauch bei
geringen technischen Voraussetzungen sowie einfachen Konstruktionen
gekennzeichnet.
beherrschen
In einen bestimmten Raum so mit Feuer wirken können, daß dem Feind dort die
Handlungsfreiheit verwehr ist.
bekämpfen
Feuerauftrag/Feueranforderung: Allgemein gehaltener Ausdruck für Feueraufträge
und Feueranforderungen, wenn sich die beabsichtigte Art der Wirkung noch nicht
festlegen läßt oder dem Ausführenden überlassen bleiben soll.
Beleuchtungsstufe
Grad der Beleuchtung eines Fahrzeugs.
Die Beleuchtungsstufe für Märsche bei Nacht befielt der militärische Führer,
der den Marsch anordnet, entsprechend der Lage.
Sind Sperrlinien für Beleuchtung festgelegt, dürfen diese feindwärts höchstens
mit der befohlenen Beleuchtungsstufe überschritten werden.
Bereitschaftsgrad
Zustand, den Truppen einzunehmen haben, um
-unverzüglich oder
-zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
-nach Ablauf einer festgesetzten Zeitspanne oder
-nach Durchführen bestimmter Maßnahmen
einen Auftrag erfüllen oder eine Funktion ausüben zu können.
Bereitschaftsgrade dienen dazu, die Reaktionszeit der jeweiligen Lage
anzupassen. Sie erleichtern Befehlsgebung und Meldewesen. Bedeutung und Inhalt
der verschiedenen Bereitschaftsgrade können allgemein oder für einzelne
Truppengattungen entsprechend deren Eigenart unterschiedlich festgelegt sein.
Betriebsart
Diejenige Art des Fernmeldebetriebs, für die Fernmeldeanlage oder ein
Fernmeldegerät geeignet, verwendbar oder geschaltet ist.
Betriebsarten sind z.B.
-Sprechen (Telephonie, Sprechfunk)
-Schreiben (Fernschreiber, Schreibfunk)
-Tasten (Telegrafie, Tastfunk)
Beurteilung der Lage
Überlegungen zu einer bestimmten Lage als Vorbereitung für den Entschluß. In
der Beurteilung der Lage werden die auf die Erfüllung des Auftrages
einwirkenden Faktoren untersucht. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten des
eigenen Handelns werden anschließend gegeneinander abgewogen. Die Beurteilung
der Lage ist Teil des Führungsvorgangs
Bewegungslinie
Führungslinie, die den weg zur Aufklärung angesetzter Kräfte in groben Zügen
vorschreibt. An einen bestimmten Weg wird ein Spähtrupp nur dann gebunden, wenn
ihm eigene Kräfte folgen sollen.
Bewegungsstreifen
Der einer Truppe befristet zugewiesene, durch seitliche Grenzen festgelegte Geländestreifen,
den sie in der ganzen Breite ohne Bindung an bestimmte Straßen für Bewegungen
und auch zur Entfaltung ausnutzen kann. Bewegungsstreifen werden vor allem dann
befohlen, wenn die Truppe ins Gefecht geführt wird.
binden
Festhalten von Kräften des Feindes in einem bestimmten Raum durch Angriff oder
Vortäuschen einer Angriffsabsicht, um ihre Verwendung an anderer Stelle zu
verhindern.
In manchen Lagen kann ein Feind allein durch die Anwesenheit eigener Kräfte
gebunden werden, sofern sie für ihn eine Bedrohung darstellen.
blenden (allgemein und als Feuerauftrag/Feueranforderung)
Dem Feind für eine begrenzte Zeit – meist durch künstlichen Nebel – die
Sicht nehmen und ihn dadurch an der Beobachtung und an beobachtetem Feuer
hindern oder in seinen Bewegungen behindern.
blind abgesetzter Spruch
Einmaliges oder wiederholtes Senden einer Nachricht über Funk an eine oder
mehrere Gegenstellen, wobei die empfangende Stelle aus taktischen Gründen nicht
antworten darf oder aus technischen Gründen nicht antworten kann.
Blockverkehr
Form der Regelung des Straßenverkehrs.
Auf Straßenabschnitten, die keinen Gegenverkehr zulassen, aber für die
Durchfahrt in beiden Richtungen offen sein müssen, werden die
Verkehrsrichtungen abwechselnd gesperrt und freigegeben.
Breitkeil
Eine Grundform der Entfaltung.
Im Breitkeil kann eine große Zahl von Waffen nach vorne wirken. Die breite Form
birgt außerdem für den Feind die Gefahr sein Feuer aufzusplittern. Nachteil
ist die mögliche schnelle Bindung der vorne eingesetzten Teile und die geringe
Tiefe.

Brückenkommandant
An einer Kriegsbrücke eingesetzter Pionieroffizier, der für den technischen
Betrieb verantwortlich ist. Im stehen Pionierkräfte zur Verfügung. Ist keine
Gewässerzone eingerichtet, nimmt der Brückenkommandant auch die Aufgaben des
Leiters der Übergangsstelle wahr.
Brückenkopf
Geländeraum feindwärts eines Gewässers, den eigene Truppen besetzen und
halten, um nachfolgenden Kräften den Uferwechsel zu ermöglichen oder über das
Gewässer nach rückwärts auszuweichenden Kräften eine oder mehrere Übergangsstellen
offenzuhalten. Oft können unterstützende Waffen (Artillerie) zunächst nur vom
freundwärtigen Ufer aus eingesetzt werden.

Brückenstelle
Stelle am Gewässer, die den Einsatz einer Kriegsbrücke zuläßt oder an der
eine Kriegsbrücke geplant oder eingesetzt ist.
Chemische Kampfmittel / Kampfstoffe
à Kampfstoff
Deckname
Hauptwort als Deckbezeichnung für eine Kommandobehörde, einen Truppenteil oder
eine sonstige Dienststelle
Deckwort
Hauptwort als Deckbezeichnung für einen Begriff, eine vorher festgelegte
Nachricht oder bestimmte Maßnahmen.
Doppelreihe
Eine Grundform der Entfaltung.

Durchbruch
Lage, bei der es dem Angreifer gelungen ist, den Feind so tief zu durchstoßen,
daß dieser zunächst keinen zusammenhängenden Widerstand mehr leisten kann.
Durchfahrstelle
Eine für Fahrzeuge erkundete, oft hergerichtete und meist gekennzeichnete
Stelle, an der sich ein Gewässer durchfurten läßt.
Durchlauflinie (DL)
Quer zur Bewegungsrichtung verlaufend Führungslinie zur räumlichen und
zeitlichen Koordinierung von Bewegungen.
Der Truppe kann der Zeitpunkt befohlen werden, ab wann sie eine Durchlauflinie
überschreiten darf oder bis wann sie diese überschritten haben muß.
Bei Bewegungen über Gewässer grenzen Durchlauflinien die Gewässerzone ab.

Durchlaufpunkt
Zwischen Ablaufpunkt und Auslaufpunkt festgelegter Punkt auf einer Marschstraße,
der zu einer bestimmten Zeit zu überschreiten ist. Jede Marschstraße kann
mehrere Durchlaufpunkte haben. Sie dienen der Marsch- und Verkehrsüberwachung.
Durchlaufpunkte liegen oft an Stellen, an denen Verkehrsregelung erforderlich
ist.
Durchlaufzeit
Zeitspann zwischen dem Eintreffen des vordersten und des letzten Fahrzeugs einer
Marschkolonne, Marschgruppe oder Einheit an einem beliebigen Punkt. Sie gibt
unter Berücksichtigung der Marschgeschwindigkeit die Länge einer Marschkolonne
in Stunden oder Minuten an.
Einbruch
1. Phase des Angriff, in der die angreifende Truppe in eine vom Feind besetzte
Stellung eindringt.

2. Lage in der Verteidigung, bei der der Angreifer in oder zwischen verteidigte
Stellungen eingedrungen ist, der Zusammenhang der Verteidigung jedoch noch
gewahrt bleibt.

Eindringtiefe
Entfernung jenseits der vorderen eigenen Kampftruppenstellungen, über die Aufklärungskräfte
in feindbesetztes Gebiet eindringen
Einsatzbereitschaft
Die Fähigkeit eines Truppenteils / einer Dienststelle, gegliedert und ausgerüstet
nach KStN/KAN, einen Einsatzauftrag zu erfüllen.
Personelles und materielles Fehl, Mängel in der Ausbildung oder im Zustand es
Materials können den Kampfwert mindern, schließen jedoch die
Einsatzbereitschaft nicht aus.
Einsatzplan
Ergebnis der Planung, das zeigt, wie ein militärischer Führer die ihm für Erfüllung
seines Auftrags zur Verfügung stehenden Kräfte und Mittel einsetzen will.
Der Einsatzplan kann auch die Form einer graphischen oder tabellarischen
Darstellungen haben, die eine Übersicht über den Ablauf des Einsatzes von Kräften
nach Art, Ort und Zeit sowie die notwendige Logistik gibt.
Einschießen
Ermittlung der Schußwerte für das Wirkungsschießen von Artillerie und
Granatwerfern durch Abgabe einzelner Schüsse und deren Einmessen oder
Beobachten, wenn sonstige sichere Schießgrundlagen fehlen.
Einschießen ist vor allem dann zweckmäßig, wenn
-das Ziel sich dem Feuer nicht entziehen kann (ortsfeste Ziele, wie
Stellungsanlagen, Befestigungen),
-der Feind Auflockerung und Deckung bis zum Wirkungsschießen kaum verbessern
kann,
-der Feind in erster Linie gestört werden soll
-der Feind vor allem zum Stellungswechsel gezwungen werden soll.
Einschließung
Lage, in der eine Truppe rundum von ihren Verbindungen zu Lande abgeschnitten
ist.
Einzelbefehl
Art eines Befehls, der sich nur an einen oder einen Teil der unterstellten Führer
richtet.
Entfaltung
Auflockerung einer Truppe in der Bewegung.
Die Entfaltung erhöht die Gefechtsbereitschaft, erleichtert die Ausnutzung des
Geländes, verbessert die Wirkungsmöglichkeit der eigenen Waffen und vermindert
die feindliche Waffenwirkung. Sie erschwert aber gleichzeitig die Führung und
vermindert die Marschgeschwindigkeit.
Grundformen der Entfaltung sind Reihe, Doppelreihe, Keil, Breitkeil, für Züge
und Kompanien darüber hinaus Staffel und Kette.
Entfernungsspinne
Skizze, in der der eigene Standort, wichtige Geländepunkte und die Entfernungen
dorthin festgehalten sind. Sie dient als Hilfsmittel im Feuerkampf, vor allem
bei der Feuerleitung. Für den Feuerkampf bei Nacht und schlechter Sicht kann
die Entfernungsspinne durch die für die Richtpunkte ermittelten Werte (Erhöhung
und Seitenrichtung) ergänzt werden.
à Geländetaufe
Entschluß
Die Entscheidung eines militärischen Führers, wie er eine ihm gestellte
Aufgabe zu erfüllen beabsichtigt oder auf eine Veränderung der Lage reagiert.
Der Entschluß muß knapp und unmißverständlich die Absicht des Führers
wiedergeben; ohne auf Einzelheiten einzugehen, enthält er die Grundzüge des
Operationsplans.
Erfassungsbasis
Räumliche Anordnung von mehreren Erfassungsstellen zur Suche, Aufnahme und
Peilung elektromagnetischer Ausstrahlungen des Feindes. Nachrichtenaufklärung
wird im allgemeinen von einer Erfassungsbasis aus betrieben.
Erkundung
Sammelbegriff für alle Maßnahmen, die dazu dienen, Informationen über Gelände,
Bevölkerung, ortsfeste Anlagen, Einrichtungen und andere Umweltbedingungen zu
gewinnen.
à Pioniererkundung
erreichen
Auftrag an eine Truppe, in einen bestimmten Geländeraum zu marschieren oder
vorzugehen; der den Auftrag erteilende Führer rechnet nicht mit Feindberührung.
Fachliche Unterstellung
Sie umfaßt die Unterstellung in der Ausübung einer fachlichen Tätigkeit (z.B.
auf Verwaltungs-, ärztlichen oder veterinärärztlichen Gebiet, dem Gebiet der
Abwehr, des Feldgendarmeriewesens oder auf dem Gebiet des Kriegskarten- und
Vermessungswesens usw.).
Fahrzeugabstand
Abstand zwischen einzelnen Fahrzeugen in Metern. Auf dem Marsch beträgt der
Fahrzeugabstand 25 oder 50 m, bei starker Luftgefahr 100 m, wenn nicht sogar die
Auflösung der Kolonne in Einzelgruppen von 3 bis 5 Fahrzeugen geboten ist.
Unter besonderen Bedingungen (Nachtfahrt ohne Beleuchtung, schlechte Sicht) kann
Sichtabstand befohlen werden.
Der Fahrzeugabstand beim Übergang über Brücken kann je nach Tragfähigkeit
und Bauweise der Brücke gesondert befohlen werden.
à Marschabstand
Feindmöglichkeiten
Handlungsweisen, zu denen der Feind fähig ist und die sich auf die Durchführung
des eigenen Auftrags auswirken können.
Der Begriff „Möglichkeiten“ umfaßt nicht nur die Wahl der Gefechtsart wie
Angriff, Verteidigung, hinhaltenden Widerstand, sondern alle im Rahmen der
Gefechtsarten möglichen Einzelmaßnahmen einschließlich der Wahl des Ortes für
Angriffshandlungen.
Die „Möglichkeiten des Feindes“ werden unter Berücksichtigung aller
bekannten Faktoren erwogen, die sich auf das Gefecht auswirken und zu denen
Zeit, Raum, Wetter, Gelände, Stärke und Kräfteverteilung des Feindes gehören.
Feldbefestigung
Sammelbegriff für alle feldmäßigen Anlagen und Einrichtungen, die dem Kampf,
der Beobachtung, der Deckung und der Erleichterung des Lebens im Felde dienen.
à Geländeverstärkung
Feldmäßige Sperren
Sperre, die die Truppe mit oder ohne Unterstützung der Pioniere mit eigenen
oder vorgefundenen Mitteln anlegt. Hauptformen sind Draht- und Minensperren.
Fernmeldeverbindung
häufig statt Nachrichtenverbindung gebrauchter Ausdruck.
Die wesentlichen Fernmeldeverbindungen sind
-Drahtverbindungen, einschließlich der Ausnutzung postalischer Netze
-Funkverbindung
-Richtfunkverbindung, kann wie eine Drahtverbindung genutzt werden.
-optische Verbindung (Blinkgerät)
Verbindungen durch Einsatz von Brieftauben oder Meldehunden waren kaum von
Bedeutung.
Als Sonderfernmeldeverbindung wird eine Fernmeldeverbindung bezeichnet,
die bestimmten Bedarfsträgern oder Benutzern für einen besonderen Zweck zu
dauernder oder zeitlich begrenzter Benutzung zur Verfügung steht.
à Punkt-zu-Punkt-Verbindung
à Verkehrsart
à Verkehrsform
Feueranforderung
Anforderung von Feuerunterstützung, bei der die gewünschte Wirkung mit
festgelegten Begriffen bezeichnet wird. Begriffe für die Feueranforderung sind
z.B.
-abriegeln
-ausschalten
-bekämpfen
-beleuchten
-blenden
-niederhalten
-stören
-überwachen
-vernichten
-zerschlagen
-zerstören
Feuerart
Sammelbezeichnung für die verschiedenen Möglichkeiten des Feuerns. Feuerarten
sind
1. beim Schießen mit Handwaffen und mit Maschinenwaffen
- Einzelfeuer
- Feuerstöße
2. bei der Rohrartillerie und den Granatwerfern
- Salvenfeuer
- Gruppenfeuer
- Lagenfeuer
- geschützweises Feuer
3. bei den Nebelwerfern (Raketenwerfern)
- Teilserienfeuer
- Serienfeuer
Feuerauftrag
Auftrag für den Feuerkampf, bei dem die geforderte Wirkung mit festgelegten
Begriffen bezeichnet wird.
Diese Begriffe entsprechen denen für Feueranforderungen.
Der Feuerauftrag gibt das Ziel an und bezeichnet den Zweck, der mit dem Feuer
erreicht werden soll. Er kann außerdem Zeit und Form des Wirkungsschießen
sowie die Munitionsmenge enthalten.
à Artillerieführer
à Feuerkampf
à Wirkungsschießen
Feuereinheit
Teileinheit oder Truppenteil unter einheitlicher Feuerleitung in der Größenordnung,
die erforderlich ist, um eine ausreichende Waffenwirkung zu erzielen.
Feuereinheit ist den Regel
-bei den Kampftruppen der Zug oder die Gruppe (auch bei den schweren
Infanteriewaffen)
-bei den Panzerjägern das Geschütz
-bei der Flugabwehr die Batterie, bei der leichten Flugabwehr auch der Zug.
-bei der Rohrartillerie die Abteilung (Ausnahme bei schwerer Artillerie)
-bei den Nebelwerfern (Raketenartillerie) die Batterie oder der Zug.
Feuerkampf
Der Feuerkampf hat das Ziel, feindliche Kräfte zu vernichten oder am Handeln zu
hindern. Er soll die Angriffskraft oder den Widerstand des Feindes brechen und
eigene Bewegungen ermöglichen.
à allgemeiner Feuerkampf
à Feuerkampf, Führung des
à unmittelbare Feuerunterstützung
Feuerkampf, Führung des
1. Allgemein
Führungstätigkeit, die den Einsatz der Waffen räumlich – vor allem durch
Zielzuweisung – oft auch zeitlich und nach der beabsichtigten Wirkung regelt.
2. Artilleristisch
Art und Weise, in der ein Artillerieführer im Auftrag des Truppenführer das
Feuer der Artillerie durch Feueraufträge regelt.
Feuerkommando
Formalisierter Befehl für die Feuerleitung.
Das Feuerkommando ist in der Reihenfolge und – soweit möglich – auch im
Wortlaut festgelegt.
Feuerplan
Mittel der artilleristischen Feuerleitung, das dazu dient, das Feuer aller
unterstellten Waffen zu leiten.
Der Feuerplan wird vom Artillerieführer erarbeitet.
à Aufgabentabelle
à Plan für die Führung des
Feuerkampfes
Feuerstellung
Geländeraum, wo eine Einheit der Artillerie oder der Granatwerfer für den
Feuerkampf in Stellung geht.
Die Feuerstellung, in der eine Batterie wirkungsbereit ist, heißt
Hauptfeuerstellung.
Feuerstellungsraum
Geländeraum, der mehrere zusammengehörige Feuerstellungen der Artillerie umfaßt.
Die Feuerstellungen der Batterien einer Abteilung bilden einen
Feuerstellungsraum.
Feuerüberfall
Schlagartig einsetzendes, mit schneller Schußfolge abgegebenes Feuer.
Im Befehl für einen Feuerüberfall kann die Munitionsmenge oder die Dauer des
Feuers begrenzt werden.
Feuervorbereitung
Nach Zeiten und Zielen geplantes Feuer der Artillerie, der Granatwerfer, der
Luftstreitkräfte und anderer Waffen von einem bestimmten Zeitpunkt vor
Angriffsbeginn bis spätestens zum Einbruch der Kampftruppen.
Feuerzusammenfassung
Vereinigung des Feuers mehrerer Waffen, bei der Artillerie mehrerer Batterien
oder Abteilungen, auf ein Ziel.
Flächenmarsch
Marsch, bei dem die gesamte Breite von Bewegungsstreifen ausgenutzt wird.
Flanke
Linke oder rechte Seite einer Truppe in ihrer ganzen Tiefe.

Fliegerabwehr
Sammelbegriff für die von allen Truppen zum Schutz gegen Bedrohung aus der Luft
zu treffenden Maßnahmen.
Hierzu gehören Fliegerschutzmaßnahmen, wie Tarnung, Täuschen, Auflockerung
und Deckung, die Beobachtung des Luftraums und das Bekämpfen tieffliegender
Luftfahrzeuge oder von Luftlandungen mit allen dazu geeigneten Waffen.
à Flugabwehr
Flugabwehr
Überwachung des Luftraums und Bekämpfung feindlicher Luftfahrzeuge durch die
Flugabwehrtruppen von Heer und Luftwaffe, um Truppen und deren Einrichtungen
sowie wichtige Anlagen gegen Angriffe und Aufklärung aus der Luft zu schützen.
Flugabwehraufklärung
Aufklärung von Luftfahrzeugen durch die Flugabwehrtruppe des Heeres und der
Luftwaffe.
Sie umfaßt
-die Beobachtung und Überwachung des Luftraums,
-das Entdecken und Identifizieren von Luftfahrzeugen
-das Sammeln und Auswerten der Aufklärungsergebnisse
-das Erstellen und Weitergeben der Luftlage
-das Absetzen von Fliegerwarnungen
Die Flugabwehraufklärung wird durch den Luftraumspähdienst aller Truppen ergänzt.
Flügel
Vorderer linker und rechter Teil einer Truppe.

Front
1. Der von einer Truppe der Breite nach eingenommene Raum von ihrem linken bis
zu ihrem rechten Flügel.
2. Die Richtung zum Feind.
3. Linie, an der eine Truppe dem Feind gegenübersteht.
Führen mit Auftrag
Führungsverfahren, in dem der Unterstellte im Rahmen der Absicht des
Befehlenden weitgehend Freiheit in der Ausführung seines Auftrages hat.
Die Aufträge sollen nur die Bindungen enthalten, die für das Zusammenwirken
mit anderen unerläßlich sind und müssen mit den Kräften, Mitteln und
Befugnissen des Unterstellten erfüllbar sein.
Führen mit Auftrag verlangt Einheitlichkeit im Denken, Urteils- und Entschlußkraft
sowie verantwortungsbewußtes Handeln auf allen Ebenen.
Führung
1. Richtungsweisendes, regelndes Einwirken auf das Verhalten unterstellter
Soldaten und der Einsatz materieller Mittel, um eine Zielvorstellung zu
verwirklichen.
2. Gesamtheit der Führer eines bestimmten Bereichs; im weitesten Sinne auch die
Spitze einer Organisation oder einzelner Teilbereiche.
Die Führung gliedert sich in oberste, obere und untere Führung. Untere Führung
umfaßt alle Verbände unterhalb der Divisionsebene, obere Führung den Bereich
Division bis Heeresgruppe/ Wehrmachtsbefehlshaber, die oberste Führung die
Kriegsspitzengliederung der Wehrmacht.
Führungsebene
Bezeichnung für die Einstufung vergleichbarer militärischer
Verantwortungsbereiche in den hierarchischen Aufbau der Streitkräfte.
Die Führungsebene wird nach der Größenordnung eines Truppenteils oder
Befehlsbereichs bezeichnet, z.B. Kompanieebene, Regimentsebene, Divisionsebene,
Heeresgruppenebene.
Führungslinien
Linien, mit den die Führung Verantwortungsbereiche abgrenzt oder Bewegungen,
Feuer und sonstige Tätigkeiten von Truppen räumlich, oft auch zeitlich,
regelt. Solche Führungslinien sind z.B.
-Ablauflinie
-Angriffsachse
-Aufnahmelinie
-Bewegungslinie
-Durchlauflinie
-Grenzen
-Hauptkampflinie
-Linie für die Feuereröffnung
-Meldelinie
-Sicherungslinie
-Sperrlinie für Beleuchtung
-Verzögerungslinie
Führungsorganisation
Zusammenfassende Bezeichnung für die Einteilung der Führungsebenen, die
Aufgaben des Führungspersonals sowie für die Gliederung und den Einsatz der Führungseinrichtungen
(z.B. Stäbe und Gefechtsstände).
Führungsstaffel
à Befehlsstelle, bewegliche.
Führungsunterlagen
Unterlagen, die führungswichtige Informationen zweckmäßig und anschaulich
darstellen.
Führungsunterlagen sind vor allem Karten, Tabellen, Übersichten, Statistiken
und Pläne sowie Kriegstagebücher. Der Zweck der Darstellung bestimmt Form und
Inhalt. Führungsunterlagen sollen das Wesentliche schnelle erkennen lassen,
ohne Spezialkenntnisse verständlich sein und leicht geändert werden können,
so daß sie stets auf dem neuesten Stand sind.
Führungsvorbehalt
Befehl, mit dem ein Führer anordnet, daß über bestimmte Kräfte und Mittel
nur mit seiner Zustimmung verfügt werden darf.
Führungsvorgang
Zusammenfassende Bezeichnung für den zielgerichteten, in sich geschlossenen
Denk- und Handlungsablauf zur Lösung von Führungsaufgaben. Der Führungsvorgang
setzt mit Eingang eines Auftrags oder wesentlichen Lageänderungen ein und umfaßt
-Lagefeststellung
-Planung mit Beurteilung der Lage, Entschluß und Operationsplan
-Befehlsgebung
-Kontrolle.
Funkrelaisstelle
In eine Funkverkehrsbeziehung eingeschobene Funkstelle, die dazu dient,
aufgenommene Sendungen auf einer anderen Frequenz automatisch wieder
auszustrahlen.
Funkwiederholer
In eine Funkverkehrsbeziehung eingeschobene Funkstelle, die dazu dient,
aufgenommene Sendungen auf derselben Frequenz anschließend erneut
auszustrahlen, um dadurch den Wirkungsbereich der sendenden Stelle zu vergrößern.
Gangbarmachen des Geländes
Sammelbegriff für alle Maßnahmen, die dazu dienen, Bewegungsmöglichkeiten für
die eigene Truppe zu schaffen, zu erhalten oder zu verbessern.
Dazu gehören
-das Öffnen, Überbrücken und Räumen von Hindernissen
-das Erhalten oder Steigern der Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes, vor
allem von Straßen und
Brücken einschließlich des Baus
von Kriegs- und Behelfsbrücken.
gedeckte Aufstellung
Aufstellung von Kampffahrzeugen in der Nähe ihrer Stellungen in einem Geländeraum,
der ihnen Tarnung und möglichst auch Deckung bietet.
Die gedeckte Aufstellung wird in Zusammenhang mit den Stellungen befohlen.
Stellungen und Wege dorthin sind für den Kampf bei Tag und Nacht zu erkunden.
Es muß möglich sein, daß Feuer kurzfristig und überraschend zu eröffnen.
Eine gedeckte Aufstellung beziehen Kampffahrzeuge,
-während Stellungen erkundet oder vorbereitet werden.
-wenn die Stellungen keinen Schutz vor Bedrohung aus der Luft und vor
vorzeitiger feindlicher
Erdaufklärung bieten,
-nicht feststeht, aus welcher Stellung der Feuerkampf aufzunehmen ist.
-während des Gefechts zu versorgen ist.
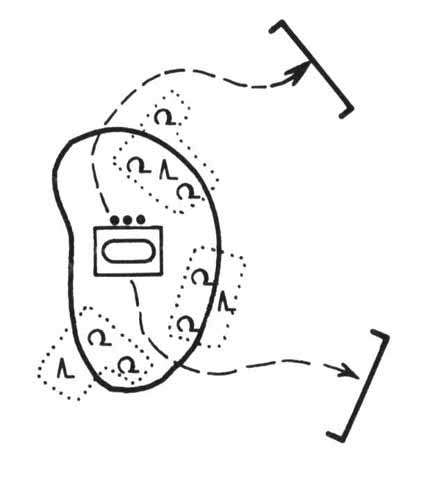
Gefecht der verbundenen Waffen
Zusammenwirken verschiedener Kräfte und Mittel auf dem Gefechtsfeld unter
einheitlicher Führung eines Truppenführers. Ziel des Gefechts der verbundenen
Waffen ist es, sowohl jeden Truppenteil und jedes Waffensystem ihrer Eigenart
entsprechend zu verwenden als auch die Gesamtheit aller Kräfte am besten zur
Wirkung zu bringen.
Gefechtsart
Von der Zielsetzung einer Operation her bestimmte Art und Weise der
Auseinandersetzung mit dem Feind.
Je nach Absicht – ob Raum gehalten, ob Raum genommen oder unter Aufgabe von
Raum Zeit gewonnen werden soll – unterscheidet man zwischen den Gefechtsarten
Abwehr/Verteidigung, Angriff und Verzögerung/hinhaltender Widerstand.
Gefechtsaufklärung
Aufklärung, die alle Truppen, die mit Feindberührung rechnen müssen oder im
Kampf stehen, dauernd und ohne besonderen Befehl betreiben.
Gefechtsgliederung
Die von Lage und Absicht abhängige Zusammensetzung der Truppen und ihre
Verteilung nach Breite und Tiefe auf dem Gefechtsfeld.
à Grundgliederung
à Truppeneinteilung
Gefechtsstand
Für eine gewisse Zeit an einem bestimmten Ort eingerichtete Befehlsstelle, von
der aus die unterstellten Kräfte geführt werden und Verbindung zur übergeordneten
Führung und zu den Nachbarn gehalten wird. Die Bezeichnung eines
Gefechtsstandes entspricht der Führungsebene, z.B. Bataillons-,
Divisionsgefechtsstand.
Großverbände können mehrere Gefechtsstände einrichten (Hauptgefechtsstand
und Rückwärtiger Gefechtsstand), sie bereiten auch Reservegefechtsstände vor
und erkunden sie zumindest.
à Befehlsstelle, bewegliche
Gefechtsstreifen
Durch seitliche Grenzen festgelegter Geländestreifen, der einer Truppe für
ihre Gefechtsführung zugewiesen ist und für den sie die Verantwortung hat.
Die Grenzen der Gefechtsstreifen erstrecken sich so weit in den Feind, wie die
Truppe für Aufklärung und Sicherung verantwortlich ist.
à Interessenbereich
à Verantwortungsbereich

Gefechtsverband
Truppe in der Größenordnung eines verstärkten Regiments oder verstärkten
Bataillons, die für eine bestimmten Aufgabe mit weitgehend selbständigen
Auftrag aus Teilen verschiedener Truppengattungen gebildet wird.
Die Bezeichnung eines Gefechtsverbandes richtet sich nach seiner
Zweckbestimmung, z.B. Angriffsverband, Verfolgungsverband, Sperrverband,
Vorausverband.
Gefechtswert
Eignung einer Truppe für einen bestimmten Auftrag.
Der Gefechtswert hängt ab von Kampfkraft und Verfügbarkeit der Truppe, sowie
von der Lage, dabei besonders von Feind, Gelände, Wetter und Sicht.
Gegenangriff
Bezeichnung für Angriffe im Rahmen der Gefechtsarten Verteidigung und
hinhaltender Widerstand / Verzögerung auf allen Führungsebenen.
Gegenangriffe sind
-Angriffe von Reserven, die entsprechend dem Operationsplan vorbereitet sind, um
vorgedrungene
feindliche Kräfte aufzufangen, zu
zerschlagen oder verlorenes Gelände zurückzugewinnen sowie
-Angriffe rasch verfügbarer Kräfte, die eine sich bietende günstige
Gelegenheit nutzen, um Teile des
Feindes zu vernichten.
Der Gegenangriff ist möglichst gegen die Flanke des eingebrochenen Gegners zu
richten. Er bedarf, besonders wenn er von stärkeren Kräften oder bei Nacht
unternommen wird, gewöhnlich eingehender Vorbereitungen. Bereitstellung,
Zeitpunkt, Ziel, Artillerieunterstützung müssen von einer Stelle geregelt
werden. Übereilung führt zum Mißerfolg
à Gegenstoß
Gegenstoß
Bezeichnung für örtliche Angriffe mit kurzem Ziel, um in die HKL
eingebrochenen Feind zurückzuwerfen, ehe er sich in dem gewonnenen Gelände
eingerichtet hat. Für einen Gegenstoß sind alle sofort greifbaren, nicht
gebundenen, Kräfte einzusetzen, ohne das der Gesamtzusammenhang der
Verteidigung aufgegeben wird. Die Schnelligkeit der Gegenmaßnahmen ist von
entscheidender Bedeutung, darf jedoch nicht zum Verzicht auf die notwendigen
Absprachen und Aufträge führen.
Gegenstöße können durch abriegelndes Feuer der Artillerie oder der schweren
Infanteriewaffen in den Rücken des eingebrochenen Feindes wirksam unterstützt
werden.
Geländehindernis
Hindernis, vor allem für die Bewegungen motorisierter und gepanzerter Truppen,
das sich aus Form, Bedeckung oder Zustand des Geländes ergibt oder von Gewässern
gebildet wird. Geländehindernisse sind z.B.
-breite Gewässer
-Einschnitte und Schluchten, Hohlwege
-Dämme
-Moore
-dichte Wälder
-Gebirge
-größere Ortschaften
-Industrieanlagen.
Geländetaufe
Verfahren zur Bezeichnung und Verschleierung von Ortsangaben und zur
Erleichterung der Befehlsgebung und der Feuerleitung. Bei der Geländetaufe
erhalten einzelne Geländeräume und –punkte charakteristische, leicht zu
merkende Namen.
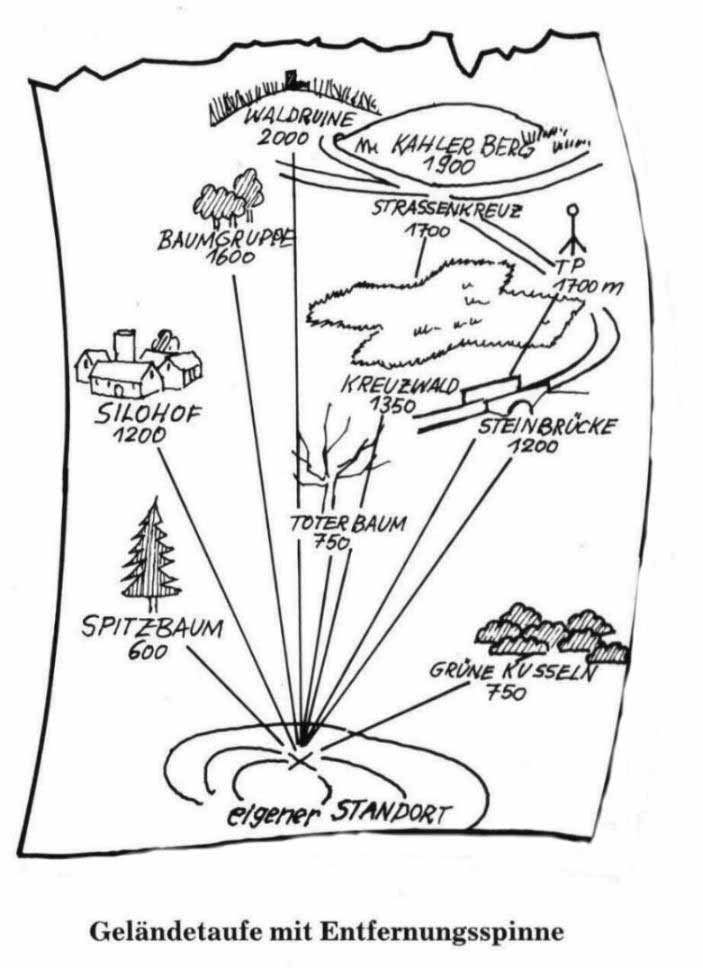
Geländeverstärkung
Sammelbegriff für Feldbefestigungen und Sperren.
Sperren sind:
-Vorbereitete Sperren (Sperreinbauten, Sprengkammern- und Schächte)
-Ständige Sperren (Bereits angelegte Panzergräben und Panzerhindernisse im
Zuge von
Befestigungslinien, Hangabstiche)
-Feldmäßige Sperren (Drahtsperren, Baumsperren, Barrikaden, Minensperren
einschl.
Scheinminensperren).
-Zerstörungen und Verwüstungen (durch Brand, Beschuß oder gezielte
Sprengungen geschaffene
Trümmerzonen).
Feldbefestigungen umfassen:
-Bau von Stellungen, Stellungssystemen und Anlagen für Kampf, Führung und
Versorgung.
-Bau von Scheinstellungen und Scheinanlagen
-Freimachen von Schußfeld, Maßnahmen für Brandschutz
Geleitschutz
Schutz marschierender Truppenteile, die sich selbst nicht ausreichend sichern können,
durch Eingliederung kampfkräftiger Teile (z.B. Begleitung von
Versorgungskolonnen durch bandengefährdetes Gebiet).
Gesamtbefehl
Art eines Befehls, der an alle unmittelbar unterstellten Führer ergeht und sie
gleichlautend und etwa zur gleichen Zeit über alle erteilten Aufträge
unterrichtet.
Gewässersicherung
Wird sichergestellt durch Pioniere, die das auf dem Gewässer eingesetzte
Kriegsbrückengerät gegen Treibgut, Flußtreibminen oder feindliche Angriffe
vom Wasser her schützen sollen. Einsatzort, Stärke und Ausrüstung befiehlt
der Leiter des Brückenschlages, der Brückenkommandant oder der Leiter des Fährbetriebs.
Gewässerzone
Geländestreifen, der beiderseits eines Gewässers jeweils in einem Abstand bis
zu 3 km von je einer Durchlauflinie begrenzt wird. Stromauf und stromab schließt
die Gewässerzone den Raum ein, der zur Sicherung der Übergangsstellen
erforderlich ist.
Die Einrichtung von Gewässerzonen soll Massierungen in Ufernähe verhindern,
daher sind Kontrollpunkte sowie Sammel- und Abrufräume für übergehende
Truppen an den die Gewässerzone begrenzenden Durchlauflinien vorzusehen, für
die Kontrolle der Zufahrt zum Gewässer und den Abruf der Truppen ist
Feldgendarmerie vorzusehen. Die Gewässerzone ist von allen Kräften
freizuhalten, die nicht unmittelbar zur Unterstützung und zum Schutz des Übergangs
erforderlich sind. Übergehende Truppen haben sie in einem Zuge zu durchqueren.
Beim Angriff über Gewässer befiehlt der Truppenführer eine Gewässerzone erst
dann, wen die Truppe am jenseitigen Ufer so viel Raum gewonnen hat, daß die Übergangsstellen
beobachtetem feindlichem Feuer entzogen sind.

gewinnen
Auftrag an eine Truppe, in einen bestimmten Geländeraum vorzugehen oder zu
marschieren und ihn notfalls ihm Angriff zu nehmen; der den Auftrag erteilende Führer
hält Feindberührung für möglich.
Grenze
Führungslinie zur räumlichen Abgrenzung der Verantwortlichkeit und der
Befugnisse.
Grundgliederung
Die einer Kriegsstärkenachweisung oder einem Aufstellungsbefehl festgelegte
Zusammensetzung von Truppen, Stäben, Dienststellung und militärischen
Einrichtungen.
Gruppenfeuer
Feuerart der Rohrartillerie und der Granatwerfer.
Beim Gruppenfeuer schießen alle Waffen die befohlene Schußzahl selbständig,
wobei in der Regel die erste Gruppe als Salve geschossen wird.
halten
1. Taktisch
Eine Raum oder eine Stellung gegen alle Angriffe des Feindes verteidigen.
2. Fernmeldedienst
Ohne erneuten Befehl eine Fernmeldeverbindung zu einer Stelle aufrecht erhalten,
auch wenn diese an einen anderen Ort verlegt.
Handstreich
Überraschende Wegnahme eines wichtigen Geländeteils oder eines Objekts durch kühnes
Zupacken. Ein Handstreich setzt eine günstige Gelegenheit voraus, den Feind zu
überrumpeln und erfordert die Fähigkeit des örtlichen Führers, sie zu
erkennen und auszunutzen.
Hauptempfangsfrequenz
Frequenz, auf der mit einem zuverlässigen Funkempfang gerechnet bzw. auf der
der Hauptanteil des Funkempfangs abgewickelt werden kann.
Hauptkampffeld
à Verteidigung
Hauptkampflinie (HKL)
Allgemeine Linie als Anhalt für die Lage der vordersten
Verteidigungsstellungen. Diese Linie stellt den Zusammenhang der Verteidigung
sicher und muß nach Abschluß des Verteidigungsgefechts wieder in eigener Hand
sein.
Hauptverbandplatz
Sanitätseinrichtung, in welcher die erste chirurgische Betreuung Verwundeter
stattfindet. Wird bei der Division durch die Sanitätskompanien eingerichtet.
Hindernis
Sammelbegriff für schwieriges Gelände, Sperren und Verwüstungen, die
Bewegungen aufhalten.
Hinhaltender Widerstand
Der hinhaltende Widerstand soll den Gegner unter für ihn möglichst hohen
Verlusten aufhalten, ohne daß sich der Widerstand Leistende einen ernsten
Kampfe aussetzt. Hierzu muß dem Angriff des Gegners zur rechten Zeit
ausgewichen und Gelände preisgegeben werden.
Der hinhaltende Widerstand wird aus einer Widerstandslinie geleistet und je nach
den Umständen aus weiteren Widerstandslinien fortgesetzt, auf die kämpfend
oder in einem Zuge ausgewichen wird. Günstige Gelegenheiten sind für Gegenstöße
und Gegenangriffe mit kurzem Ziel zu nutzen.
à Aufnahme
à Verzögerung
Hinterhalt
Vorbereitete, versteckte Aufstellung einer Truppe in einem
dafür günstigen Gelände zu dem Zweck, dort Feindkräften aufzulauern und sie
mit Feuer zu überfallen oder unvermutet anzugreifen.

Interessenbereich
Teil des Kriegsschauplatzes, in dem Informationen über die Lageentwicklung für
die Operationsführung eines Kommandeurs von Bedeutung sind. Er umfaßt den
Verantwortungsbereich der nächsthöheren Führungsebene und sofern der eigene
Verband an der Grenze dieses Verantwortungsbereichs eingesetzt ist, zusätzlich
den Nachbargefechtsstreifen.
à Verantwortungsbereich

Jagdkampf
Kleinere, aufeinander und auf den Operationsplan des übergeordneten Führers
abgestimmte Operationen von Jagdkommandos in einem bestimmten Raum, um Feindkräfte
zu schwächen, zu stören, zu täuschen und zu binden.
Der Jagdkampf ist gekennzeichnet durch Wechsel von Verbergen und überraschendem
Zuschlagen in Form von Handstreichen oder aus dem Hinterhalt.
Jagdkommando
Kräfte bis zur Stärke etwa eines Zuges für Aufträge im Jagdkampf.
Kampf durch die Tiefe
Phase des Angriffs, in der die Truppe nach Annäherung und Einbruch ihren
Angriff gegen weiteren Widerstand bis zu ihrem Angriffsziel fortsetzt. Dabei können
sich Annäherung und Einbruch mehrmals wiederholen.

Kampfentfernung
Bereich, in dem eine Waffe mit ausreichendem Erfolg eingesetzt werden kann.
Kampfkraft
Leistungsvermögen der Truppe, das auf ihrer personellen und materiellen Stärke,
der Art ihrer Ausrüstung, dem Grad ihrer Beweglichkeit, dem Stand ihrer
Versorgung und der Leistungsfähigkeit ihrer Führungsmittel beruht.
Über diese meßbaren Faktoren hinaus wirken sich
-der Kampfwille der Soldaten,
-die Befähigung des Führers,
-der Stand der Ausbildung und
-der Zustand der Truppe
wesentlich auf die Kampfkraft aus.
à Gefechtswert
Kampfstoff, chemischer
Aus chemischen Verbindungen bestehendes Kampfmittel, das auf Menschen und Tiere
tödliche Wirkung hat oder sie vorübergehend oder nachhaltig kampfunfähig
macht.
Reizstoffe, die den Menschen nur vorübergehend in seiner Kampffähigkeit
behindern, fallen nicht unter diesen Begriff.
Keil
Eine Grundform der Entfaltung. Beim Keil werden die Hauptkräfte eines Verbandes
oder einer Einheit durch die tiefe Gliederung in der Bewegung verfügbar
gehalten und vor überraschenden Auflaufen auf den Feind geschützt. Nachteil
ist, daß zunächst nur ein Teil der Waffen mit Feuer auf den Feind wirken kann.

Kette
Eine Grundform der Entfaltung. Sie bringt die geschlossene Feuerkraft des Zuges
zur Wirkung und gewährleistet die gegenseitige Unterstützung, wirkt allerdings
nur in einer Richtung und ist anfällig für Flankenbedrohungen.
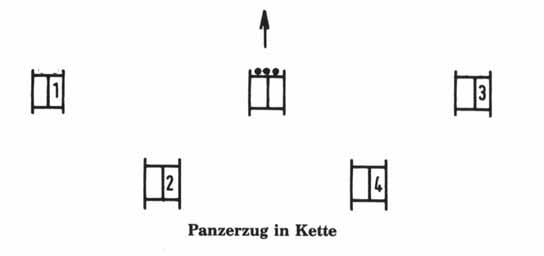
Kommandant der Übergänge (KdÜ)
Pionierstabsoffizier, der an breiten Gewässern die technischen Voraussetzungen
für die geforderte Übergangsleistung zu schaffen hat. Er setzt die Pionierkräfte
ein und regelt die Zusammenarbeit der Leiter der Übergangsstellen mit den übergehenden
Truppen, den Verkehrs- und Transportdienststellen.
Kommando
1. Formelbefehl, der dem Untergebenen keinen Ermessensspielraum läßt.
Kommandos sind in Dienstvorschriften für bestimmte Tätigkeiten im Wortlaut
festgelegt. Sie können auch durch Zeichen gegeben werden.
2. Bezeichnung bestimmter Stäbe (Divisionskommando, Korpskommando)
3. Vorübergehende oder ständige, für bestimmte Aufgaben vorgesehene
Zusammenfassung von Soldaten in meist geringer Stärke unter einem Führer (z.B.
Sprengkommando).
Kommandobehörden
Kommandobehörden sind militärische Dienststellen vom Divisionskommando an aufwärts,
die über Truppen befehlen.
Kontaktfrequenz
Festgelegte Frequenz zur Wiederaufnahme von Funkverkehrsbeziehungen, die auf
anderen Frequenzen abgerissen sind. Kontaktfrequenzen dienen nur der
Verbindungsaufnahme, sie dürfen zur weiteren Betriebsabwicklung nicht benutzt
werden.
Kontrolloffizier
Offizier oder Unteroffizier, der Aufgabe hat, den planmäßigen Verlauf des
Marsches zu überwachen. Kontrolloffiziere sind durch Armbinden kenntlich und können
mit Sondervollmachten versehen sein.
Kontrollpunkt
1. Einrichtung am Rande der Gewässerzone zur Regelung und Überwachung der
Bewegungen über das Gewässer.
Am Kontrollpunkt befinden sich in der Regel Kontrollorgane mit
Fernmeldeverbindungen, häufig gestellt durch die Feldgendarmerie oder von
Verkehrsregelungskräften. Hier nehmen die übergehenden Truppen frühzeitig
Verbindung mit dem Leiter der Übergangsstelle auf. Am Kontrollpunkt ist das
Ableiten ankommender Marschverbände von der Marschstraße in Sammel- und Warteräume
vorzusehen, um Massierungen in der Gewässerzone zu vermeiden.
2. Einrichtung zur Personen- und Fahrzeugkontrolle im Vorfeld von gesicherten
Objekten. Kontrollpunkte bestehen aus Kontrollposten und Deckungskräften, sie
sind zu kennzeichnen und je nach Lage durch Sperren zu sichern.

Krankensammelpunkte
Auf dem Marsch und in der Unterkunft werden durch die Sanitätskompanien ein
oder mehrere leicht erreichbare Krankensammelpunkte eingerichtet, denen die
Truppen ihre Verwundeten und Kranken zuführen.
Krankensammelstelle
Krankensammelstellen werden durch die Krankentransportabteilungen oder andere
Sanitätseinheiten der Armee an Eisenbahnen, Straßen und anderen Verkehrswegen
dort eingerichtet, wo starker Zustrom von Verwundeten und Kranken zu erwarten
ist. Von hier werden die Verwundeten und Kranken in Kriegs- oder
Leichtkrankenlazarette weitertransportiert.
Kriegsbrücken
Schnell zu bauende und abzubauende Brücke aus vorgefertigten Gerät für einen
zeitlich begrenzten Einsatz. Kriegsbrückengerät kann meistens auch im Fährbetrieb
eingesetzt werden; es ist möglichst schnell wieder freizumachen und durch
Behelfsbrücken oder wiederhergestellte feste Brücken zu ersetzen.
Künstlicher Nebel
à Nebel, künstlicher
Lage
Gesamtheit aller Faktoren, die auf eine Truppe in einem bestimmten Raum in einer
bestimmten Zeit einwirken. Dazu gehören vor allem
-eigene Lage und eigener Auftrag einschließlich der Versorgung
-Feindlage
-Umweltbedingungen (Gelände, Wetter, Sicht, eventuell auch Lage der Bevölkerung)
Lagefeststellung
Sammeln, Ordnen, Speichern, Darstellen, Vergleichen, Bewerten und Auswerten von
Informationen aller Art im eigenen Bereich und über den Feind.
Die eingehenden und beschafften Informationen werden ermittelt, aufbereitet und
zu einer Aussage über den Zustand des Feindes, der eigenen Truppe und der
Umweltbedingungen verarbeitet.
Die Lagefeststellung ist Bestandteil des Führungsvorganges.
Lagenfeuer
Feuerart der Rohrartillerie und der Granatwerfer.
Beim Lagenfeuer schießen die Waffen einer Batterie oder eines Zuges an einem Flügel
beginnend nacheinander.
Lähmung
Maßnahme, die dem Feind die Nutzung wichtiger militärischer und ziviler
Anlagen, Einrichtungen, Geräte und Vorräte für begrenzte Zeit verwehrt, ohne
daß umfangreiche Zerstörungen stattfinden. Lähmungen können z.B. durch den
Ausbau für den Betrieb entscheidender Bauteile erfolgen.
Leiter der Fernmelde- (Nachrichten-) Zentrale
Fernmeldeoffizier, der für die innere und äußere Organisation der
Fernmeldezentrale verantwortlich ist. Ist kein Leiter der Fernmeldezentrale
eingesetzt, nimmt diese Aufgaben der Leiter des Fernmeldebetriebs wahr.
Leiter der Übergangsstelle
Für eine Übergangsstelle eingeteilter Führer, der den Uferwechsel von Truppen
entsprechend dem Übergangsplan leitet. Seine Aufgaben sind im allgemeinen
-den Bewegungsablauf über das Gewässer zu steuern,
-die Übergangsstellen einschließlich der Zu- und Abfahrtswege zu kennzeichnen,
zu sichern und
betriebsbereit zu erhalten.
Leiter des Brückenschlags
Pionieroffizier, der einen Kriegsbrückenschlag vorbereitet und dessen
technischen Ablauf leitet.
Leiter des Fernmeldebetriebs
Fernmeldeoffizier, der dem Führer des Gefechtsstandes für den Fernmeldebetrieb
auf dem Gefechtsstand verantwortlich ist.
Er sorgt dafür, daß alle Fernmeldemittel und –verbindungen betriebsbereit
sind. Er unterrichtet den Führer des Gefechtsstandes und den Stab über die
verfügbaren Fernmeldeverbindungen, berät sie und steuert den Fernmeldebetrieb.
Lenken des Feuers
Sammelbezeichnung für alle Maßnahmen, mit denen Beobachter der Artillerie oder
auch Führer anderer Truppengattungen das Einschießen oder Wirkungsschießen
durchführen.
Linie für die Feuereröffnung
Führungslinie, mit der ein Führer die Eröffnung des Feuerkampfes regelt. Die
Truppe darf das Feuer erst eröffnen, wenn der Feind diese Linie überschreitet.
Logistik
Die Lehre von der Planung, der Bereitstellung und vom Einsatz der für militärische
Zwecke erforderlichen Mittel und Dienstleistungen zur Unterstützung der
Streitkräfte und/oder die Anwendung dieser Lehre. Die Funktionen der Logistik
erstrecken sich u.a. auf
-Materialwirtschaft (Materialplanung, Materialbedarfsdeckung,
Materialbewirtschaftung,
Materialerhaltung)
-Transport- und Verkehrswesen
-Sanitätsdienst
Lösen vom Feind
Operation, bei der eine im Kampf stehende Truppe möglichst unbemerkt und rasch
Abstand vom Feind gewinnt, um der Führung größere Handlungsfreiheit zu
verschaffen.

Lücke
Unbesetzter Geländeraum zwischen benachbarten Truppen.
Lückenweg
Weg durch Sperren, der durch Räumen geschaffen wurde oder zunächst bewußt für
Ausweichbewegungen offen gelassen wurde.
Luftnahunterstützung
Luftunterstützung, die in so großer Nähe der eigenen Landstreitkräfte wirkt,
daß deren Feuer und Bewegung und die Luftnahunterstützung aufeinander
abgestimmt sein müssen.
Luftraumspäher
Soldaten aller Truppen, die den Luftraum in Beobachtungsbereichen ständig zu
beobachten und die Truppe bei der Annährung feindlicher oder unbekannter
Luftfahrzeuge, bei Flugmotorengeräusch oder Flugabwehrfeuer zu alarmieren oder
zu warnen haben.
Luftverteidigung
Gesamtheit der Maßnahmen zur Abwehr oder Abschwächung von Angriffen
feindlicher Luftfahrzeuge.
Marschabstand
Befohlener Abstand zwischen Marschgruppen, Einheiten und Teileinheiten. Wird bei
Marsch mit Kraftfahrzeugen meist in Minuten angegeben.
Anhalt für den Marschabstand zwischen
-Marschgruppen 10 bis 30 Minuten
-Einheiten 2 bis 5 Minuten
-Teileinheiten 1 bis 2 Minuten.
Marschfolge
Befohlene Reihenfolge der Marschgruppen, Einheiten, Teileinheiten und Fahrzeuge
in einer Marschkolonne.
Die Marschfolge richtet sich in erster Linie nach der beabsichtigten Verwendung
der marschierenden Truppen und nach der während des Marsches zu berücksichtigenden
Feindlage.
Marschgeschwindigkeit
Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der eine Truppe marschieren soll. Als Anhalt
gilt für die Marschgeschwindigkeit
-bei motorisierten Truppen ohne Kettenfahrzeuge 30 – 40 km/h bei Tage
-bei motorisierten Truppen mit Kettenfahrzeugen 25 – 30 km/h bei Tage
-bei motorisierten Truppen (Rad und Kette) bei Nacht je nach Beleuchtungsstufe:
15 – 30 km/h
-bei Fußtruppen 5 – 6 km/h
-bei Radfahrern 12 – 15 km/h
-bei berittenen Truppen 8 – 10 km/h
-Infanteriedivision mit allen Truppenteilen 4km/h
Marschgruppe
Teil einer Marschkolonne, etwa in der Größe eines verstärkten Bataillons.
Marschkolonne
Zusammenfassende Bezeichnung für alle unter gemeinsamer Führung und zusammenhängend
auf einer Straße marschierenden Truppen, unabhängig von ihrer Größenordnung.
Eine Marschkolonne ist je nach Größe in Marschgruppen, Einheiten und
Teileinheiten zu untergliedern.
Marschlänge
Ausdehnung einer Marschkolonne vom vordersten bis zum letzten Fahrzeug oder
Soldaten einschließlich aller Abstände, gemessen in Kilometern oder Metern.
Beispiele für Marschlängen
-Infanteriebataillon: 700 – 800 m
-Infanterieregiment: 2600 – 3000 m
-leichte Artillerieabteilung: 1000 – 1100 m
Marschleistungen
An einem Tage (Tagesmarsch) können unter günstigen Verhältnissen zurückgelegen:
-eine Infanteriedivision mit allen Truppenteilen 25 – 30 km
-eine Kavalleriebrigade / -division 50 – 60 km
-eine motorisierte Division / Panzerdivision 150 – 200 km.
Marschpause
Geplante Unterbrechung eines Marsches, die der Erhaltung der Leistungsfähigkeit
von Mensch und Material dient.
Marschpausen sind Technischer Halt und Rast.
Ein Technischer Halt dauert im allgemeinen 20 bis 30 Minuten - im Ausnahmefall
bis zu 1 Stunde – und dient vor allem dazu, die Fahrzeuge zu überprüfen, Schäden
zu beseitigen und Betriebsstoff nachzufüllen. Technische Halte sind alle 3 bis
4 Stunden vorzusehen.
Eine Rast dauert zwischen 30 Minuten und 3 Stunden, sie soll der Truppe genügend
Zeit zur Versorgung und Ruhe geben. Je nach Länge der Marschstrecke soll die
erste Rast eingelegt werden, wenn der größere Teil der Strecke zurückgelegt
wurde, danach alle zwei Stunden. Sollen Pferde gefüttert und getränkt werden,
muß die Dauer der Rast mindestens 2 Stunden betragen.
Marschplan
Schematische Übersicht über eine Vielzahl von Märschen, aus der die
marschierenden Truppen, deren Durchlaufzeiten und Marschrichtungen an ausgewählten,
zumeist verkehrskritischen Durchlaufpunkten (Engstellen, Gewässerübergänge,
Kreuzungspunkte) ersichtlich sind.
Der Marschplan dient als Hilfsmittel bei Planung, Bearbeitung, Überwachung und
Steuerung von Märschen.
Marschüberwachung
Maßnahmen des Führers einer Marschkolonne zur Kontrolle und Beeinflussung des
Marschablaufes sowie der Marschdisziplin. Organe der Marschüberwachung sind
-Ablaufoffizier
-Kontrolloffizier
-Schließender
-Anschlußkommandos
Die Organe der Marschüberwachung arbeiten mit den im Verkehrsdienst
eingesetzten Kräften (Feldgendarmerie, Verkehrsregelungsbataillone) und ggf.
der Polizei zusammen.
Meldekopf
1. Einrichtung für die Übermittlung von Befehlen, Meldungen und anderen
Informationen. Meldeköpfe liegen vor allem an Marschstraßen oder an leicht
auffindbaren Geländepunkten. Sie können mit Einrichtungen der im
Verkehrsdienst eingesetzten Kräfte (Feldgendarmerie) oder mit
Ortskommandanturen gekoppelt sein und sollen über Fernmeldeverbindungen verfügen.
2. Einrichtung auf einem Gefechtsstand zur Kontrolle und Weiterleitung dort
eintreffender Personen.
Meldelinie (ML)
Quer zur Bewegungsrichtung verlaufende Führungslinie, an der eine Truppe den
Zeitpunkt des Erreichens und Erkenntnisse über die Lage melden muß.
Meldelinien werden vor allem den zur Aufklärung eingesetzten Kräften befohlen.
Minengasse
Minenfreier Fahrweg durch eine Minensperre.
Minenpfad
Minenfreier Fußweg durch eine Minensperre.
Nachhut
Kräfte zur Sicherung der Marschkolonne nach hinten.
Stärke und Zusammensetzung der Nachhut sind so zu befehlen, daß sie die
marschierende Truppe gegen nachdrängenden Feind schützen kann.
Nachkommando
Kommando, das eine Truppe zur Abwicklung bestimmter Aufträge zurückläßt
Nachrichtenaufklärung
Aufklären des feindlichen Fernmeldeverkehrs und dessen technische, betriebliche
und taktische Auswertung.
Nachrichtenführer
Bezeichnung für einen Führer der Nachrichtentruppe, der seinen Truppenführer
in Fragen des Nachrichten- (Fernmelde-) wesens berät, den Einsatz der
Nachrichtentruppe vorschlägt und im Auftrag des Truppenführers die
entsprechenden Befehle gibt. Nachrichtenführer sind im allgemeinen
-bei der Division der Kommandeur der Divisions-Nachrichtenabteilung,
-beim Korps der Kommandeur der Korps-Nachrichtenabteilung,
-bei der Armee der Kommandeur des Armee-Nachrichtenregiments, soweit im Stab der
Armee kein
eigener Spezialstabsoffizier für
das Nachrichtenwesen vorhanden ist.
Nachrichtenverbindung
à Fernmeldeverbindung
Nachrichtenzentrale
Zusammenfassung von Fernmeldeteilen bei Dienststellen oder Gefechtsständen. Die
Nachrichtenzentrale besteht in der Regel aus
-dem Leiter der Nachrichtenzentrale Leiter des Nachrichtenbetriebs
-der Fernsprech-/Fernschreibzelle
-der Funkzelle
-der Schlüsselzelle und der
-der Übertragungszelle (bei Bedarf).
Die Zellen können in kleineren Verhältnissen auch nur aus einem Trupp
bestehen.
Der Leiter der Nachrichtenzentrale kann zugleich Leiter des Nachrichtenbetriebs
sein. Vom Korps an aufwärts gibt es meist einen Leiter der Nachrichtenzentrale
und einen Leiter des Nachrichtenbetriebs.
Nachtaufstellung
Im Vergleich zum Tag unterschiedlicher Einsatz der Kräfte, der vor allem von
den geänderten Sichtverhältnissen bestimmt wird.
Nachtruppen
Truppen, die beim Lösen vom Feind das Zurückgehen der Hauptkräfte
verschleiern und diese während des Ausweichens gegen ein Nachstoßen des
Feindes schützen.
Nebel, künstlicher
Durch Einsatz von Nebelstoffen verursachte Sichtbehinderung.
-Künstlicher Nebel blendet den Feind und erschwert seine Gefechtstätigkeit
-entzieht die eigene Truppe und Anlagen der feindlichen Erd- und Luftbeobachtung
-täuscht den Feind.
Die Nebelwirkung unterliegt starkem Einfluß von Wetter und Gelände. Plötzlich
drehender Wind kann dazu führen, das gegen den Feind eingesetzter Nebel zu
einer Behinderung der eigenen Maßnahmen wird.
Eine Batterie leichte Feldhaubitzen kann mit 8 – 16 Schuß eine Nebelwand von
150 m Breite erzeugen. Sie benötigt zum Unterhalten der Nebelwand pro Minute 4
– 6 Schuß.
Eine Batterie schwere Feldhaubitzen kann mit 4 – 8 Schuß eine Nebelwand von
200 m Breite erzeugen und diese Wand mit 2 – 4 Schuß pro Minute unterhalten.
Neben-Kreisteilnehmer
Funkstellen, die den Funkverkehr lediglich mithören und nur nach Aufforderung
oder Genehmigung oder in Krisenlagen selbst senden dürfen.
nehmen (auch: In Besitz nehmen)
Auftrag an eine Truppe, einen bestimmten Geländeraum dem Feind durch Angriff zu
entreißen; mit Feindwiderstand ist auf jeden Fall zu rechnen.
niederhalten (allgemein und als Feuerauftrag / Feueranforderung)
Den Feind für begrenzte Zeit durch Feuer in Deckung zwingen und ihn dadurch am
Kampf hindern. Zum Niederhalten einer feindlichen Batterie sind mindestens 120
Schuß l.F.H. oder 80 Schuß s.F.H. je Stunde erforderlich.
Offene Stadt
Ortschaft, die nach einseitiger Erklärung oder nach Vereinbarung nicht
verteidigt wird. Eine Offene Stadt muß dem Zugriff des Feindes offenstehen, Der
Zutritt darf dem Feind auch nicht durch Anlagen und Streitkräfte außerhalb der
Ortschaft verwehrt werden.
offene Stellung
Stellungsart, die weder Deckung gegen Flachfeuer noch gegen feindliche
Beobachtung von der Erde aus bietet. Aus einer offenen Stellung wird nur dann
gekämpft, wenn keine teilgedeckte oder versteckte Stellung vorhanden ist.
Operation
Zeitlich und räumlich zusammenhängende Handlung e i n e r Seite.
Die Operation ist immer auf ein bestimmtes Ziel gerichtet und kann Bewegungen,
Kampfhandlungen und sonstige Maßnahmen jeder Art und jeden Umfangs umfassen.
Trifft eine Operation auf eine der a
n d e r e n Seite, so kommt
es zum Gefecht.
Operationsbefehl
Befehl für Vorbereitung und Durchführung einer Operation.
Er enthält alle notwendigen Informationen über die Lage und als Kernstück die
Aufträge an die unterstellten Führer.
Der Operationsbefehl kann mündliche, schriftliche, graphische oder eine
gemischte Form haben. Er kann als Einzelbefehl oder Gesamtbefehl gegeben werden.
Vorbefehle sind zweckmäßig, oft notwendig.
Operationsbefehle sind z.B.
-Gefechtsbefehle
-Marschbefehle
-Befehle für die Durchführung der Versorgung und die Führung der
Versorgungstruppen.
Der Zweck ist des Operationsbefehl ist aus seiner Bezeichnung zu erkennen, z.B.
-Regimentsbefehl für den Angriff am ...
-Divisionsbefehl Nr. ... für den Marsch in den Raum ...
-Armeebefehl für die Versorgung bei der Verteidigung im Raum ...
Operationsfreiheit
Lage, die es einem militärischen Führer erlaubt, seine Kräfte jederzeit so
einzusetzen, wie es zur Erfüllung seines Auftrages notwendig ist.
Operationsplan
Ergebnis der Planung, wie eine Operation durchgeführt werden soll.
Ausgehend vom Entschluß legt der militärische Führer mit seinem
Operationsplan – meist graphisch auf der Karte – in großen Zügen die
Gefechtsgliederung und das beabsichtigte räumliche, wenn notwendig auch das
zeitliche Zusammenwirken der Kräfte fest.
Der Operationsplan bildet die Grundlage für die Befehlsgebung.
Ordnung des Raumes
Zuweisung von Zonen, Gebieten, Räumen, Objekten, Gefechts- oder
Bewegungsstreifen sowie von Straßen durch einen militärischen Führer an Kräfte
in seinem Verantwortungsbereich entsprechend ihrem Raumbedarf, ihren Aufträgen
und Tätigkeiten.
Die Ordnung des Raumes hat den Zweck, Zuständigkeiten zu regeln und
gegenseitige Behinderungen auszuschließen.
Panzerabwehr aller Truppen
Tätigkeiten, die jeder Soldat zur Abwehr feindlicher gepanzerter Kampffahrzeuge
beherrschen muß. Hierzu gehören vor allem:
-Auflockerung, Deckung nutzen, Tarnen und Täuschen
-Erkennen und Melden feindlicher Panzer
-Kampf mit Panzerabwehrmitteln.
Pioniererkundung
Erkundung für die pioniertechnische Beratung des Truppenführers sowie für die
Planung und Durchführung von Pioniereinsätzen. Sie umfaßt
-Art und Umfang des bevorstehenden Pioniereinsatzes
-Feststellung technischer Einzelheiten
-Ermittlung des Kräfte-, Mittel- und Zeitbedarfs.
Pionierführer
Bezeichnung für einen Führer der Pioniertruppe, der seinen Truppenführer in
Fragen des Pionierwesens berät, den Einsatz der Pioniertruppe vorschlägt und
im Auftrag des Truppenführers die entsprechenden Befehle gibt.
Pionierführer der Division war der Kommandeur des Divisions-Pionierbataillons,
Pionierführer des Korps je nach Art und Umfang der zugeteilten Pionierkräfte
ein Bataillons- oder Regimentskommandeur der Pioniere oder eines zugeteilten
Pionier-Regimentsstabes z.b.V.; Pionierführer der Armee der Regimentskommandeur
eines Pionier-Regimentsstabes z.b.V. oder ein Höherer Pionierführer.
Plan für die Führung des Feuerkampfes
Ergebnis der Planung des Artillerieführers, wie ein Operation durch Feuer
unterstützt werden soll.
Der Plan regelt den Feuerkampf der Artillerie entsprechend den vom Truppenführer
bestimmten Schwerpunkten für die artilleristische Aufklärung und Waffenwirkung
und koordiniert ihn mit den Operationen der Kampftruppen und dem Sperrplan.
Plan für die Stabsarbeit
Mittel für die Koordinierung der Stabsarbeit bei größeren Aufgaben.
Der Plan regelt, wer was bis zu welchem Zeitpunkt zu erledigen hat und bestimmt
die Zusammenarbeit.
Planschießen
Wirkungsschießen, das ohne Beobachtung der Ziele gelenkt wird.
Die Schußwerte werden aus den Kartenwerten und aus den ballistischen sowie
meteorologischen Werten ermittelt.
Planschießen wird angewendet, wenn die Artillerie
-das Feindziel durch Feuer überraschen will,
-ein vorzeitiges Aufklären der eigenen Feuerstellungen verhindern will,
-Einschießen auf ein Ziel aus taktischen Gründen (Überraschung) unterlassen
will,
-ein Ziel nicht beobachtet werden kann.
Punkt-zu-Punkt-Verbindung
Unmittelbare Verbindung zwischen zwei Fernmelde-Endeinrichtungen, z.B.
Fernsprechgeräten oder Fernschreibern.
Reihe
Grundform der Entfaltung. Bei der Reihe sind die Truppen tief und schmal
gegliedert, so daß die Hauptkräfte eines Verbandes oder einer Einheit in der
Bewegung verfügbar gehalten und vor überraschenden Auflaufen auf den Feind
geschützt sind. Eine schnelle Reaktion auf Flankenbedrohungen ist möglich.
Nachteil ist, daß zunächst nur die Spitze mit Feuer auf den Feind wirken kann.
Reserve
Truppen oder Mittel, die ein Führer zu seiner Verfügung hält, um sie erst
dann einzusetzen, wenn er es aufgrund der Lageentwicklung für erforderlich hält.
Wird eine Reserve eingesetzt, ist anzustreben, sofort aus ungebundenen Teilen
eine neue Reserve zu bilden.
Der übergeordnete Führer kann Reserven unter seinen Führungsvorbehalt
stellen.
Reservegefechtsstand
Gefechtsstand, der bei Ausfall des Hauptgefechtsstandes die Führung übernimmt.
Läßt Feindwirkung das Beziehen des Reservegefechtstandes nicht zu, so kann die
Operation vorübergehend von
-einem Gefechtsstand der Artillerie
-dem Gefechtsstand eines anderen unterstellten Verbandes
-dem Rückwärtigen Gefechtsstand (sofern vorhanden)
geführt werden. Entscheidend ist das Vorhandensein von Nachrichtenverbindungen.
Richtungsverkehr
1. Fernmeldeverkehr, bei dem zwischen zwei Stellen/Einrichtungen in nur einer
Richtung gesendet wird.
2. Straßenverkehr, bei dem allen oder bestimmten Verkehrsteilnehmern eine
Verkehrsrichtung unter voller oder teilweiser Sperrung des Gegenverkehrs
zugewisen wird.
à Blockverkehr
Rollfähigkeit
Zustand eines Schadgeräts, der ein Abschleppen mit Hilfe von Zugmitteln ermöglicht.
Rückwärtige Gebiete
Allgemeine Bezeichnung für Gebiete hinter einer zum Kampf gegliederten Truppe.
Rundstrahlverfahren
Verfahren zur Übermittlung von Nachrichten an eine Anzahl von Funkstellen
(Empfangsstellen), die Empfang nicht quittieren.
Salvenfeuer
Feuerart der Rohrartillerie und der Granatwerfer.
Beim Salvenfeuer schießen alle beteiligten Waffen gleichzeitig.
Sanitätszone, Sanitätsort
Gebiete oder Ortschaften, die nach gegenseitiger Vereinbarung auf eigenem oder
besetztem Gebiet als Sanitätszone eingerichtet werden, um in ihnen Verwundete
oder Kranke vor weiteren Angriffen zu schützen. Sanitätszonen und –orte
werden durch Schutzzeichen gekennzeichnet.
Schadmaterialsammelpunkt
Einrichtung der Feldzeug-/Instandsetzungstruppe an Marschstraßen zur Unterstützung
von Großverbänden auf dem Marsch.
Schließender
Von der marschierenden Truppe eingeteilter Offizier oder Unteroffizier, der am
Ende der Marschkolonne fährt und Marschüberwachungsaufgaben wahrnimmt. Er hat
selbständig Verbindung mit den entlang der Marschstraße eingesetzten Organen
der Marschüberwachung, der Verkehrsführung und den zur Verkehrsregelung
eingesetzten Kräften aufzunehmen.
Schlüsselgelände
Teil des Gefechtsfeldes, dessen Besitz oder Beherrschung für den Verlauf eines
Gefechts von entscheidender Bedeutung ist; vor allem in der Verteidigung darf
das Schlüsselgelände nicht in die Hand des Feindes fallen.
Sicherung
Sammelbegriff für alle Vorkehrungen, die dazu dienen
-die Truppe vor Überraschungen durch den Feind zu schützen und ihr bei
Angriffen Zeit für
Gegenmaßnahmen zu verschaffen
sowie
-Räume und Objekte vor dem Zugriff des Feindes so lange zu bewahren, bis zusätzliche
Kräfte
eingreifen.
Sicherungslinie (SL)
Führungslinie als Anhalt für die Aufstellung der Sicherungskräfte an der HKL
oder bei der Sicherung eines Raumes.
Sie wird dort festgelegt, wo der Feind spätestens zum Kampf gestellt werden muß,
so daß die Truppe rechtzeitig Gegenmaßnahmen treffen kann.
Spähtrupp
Organ der Aufklärung und der Gefechtsaufklärung, der Erkundung und der
Sicherung.
Spähtrupps haben die Aufgabe, ein klares Bild vom Feind, über die eigene Lage
und die Umwelt zu verschaffen, Verbindungen zu anderen Truppen herzustellen oder
zu halten und die eigene Truppe vor Überraschungen zu schützen. Sie können
beweglich oder stehend an bestimmten Geländepunkten eingesetzt werden.
Sperre
Hindernis, das angelegt wird, um die Bewegungen des Feindes aufzuhalten, zu
erschweren oder in bestimmte Richtungen zu lenken. Es gibt
-Vorbereitete Sperren
-Feldmäßige Sperren
-Ständige Sperren
à Geländeverstärkung
Sperreinbauten
Vorrichtungen an Brücken, anderen Bauwerken und Verkehrsanlagen, die der Truppe
das Anlegen von Sperren erleichtert. Dazu gehören
-Sprenganlagen
-vorbereitete Barrikaden
-Klappbrücken
Sperrfeuer
Ein in der Verteidigung an besonders gefährdeten Stellen dicht vor der eigenen
Truppe durch Einschießen vorbereitetes Feuer der Rohrartillerie und der
Granatwerfer.
Sperrfeuer wird bei Feindangriff auf Befehl des Beobachters oder auf Anforderung
eines Führers der Kampftruppen – vom Zugführer an aufwärts ausgelöst, wenn
beobachtetes Feuer nicht möglich ist. Für das Auslösen sind Stichworte und
Leuchtzeichen (z.B. rote Signalpatrone) zu vereinbaren.
Das Sperrfeuer dauert etwa zwei Minuten/ etwa 12 Schuß pro l.F.H.. Breite des
Sperrfeuers je l.F.H.-Batterie 100 m.
Sperrlinie für Beleuchtung
Führungslinie, die feindwärts nur mit der befohlenen oder einer niedrigeren
Beleuchtungsstufe überschritten werden darf.
Sperrplan
Karte oder Planpause, in welcher alle vorbereiteten und feldmäßigen Sperren
eingezeichnet sind. Dabei ist zu unterscheiden nach
-geplanten Sperren
-angelegten, aber noch passierbaren Sperren
-geschlossene oder ausgelöste Sperren.
In einer Anlage zum Sperrplan sind Einzelheiten zu den Sperren enthalten.
Sperrunterlagen
Unterlagen mit technischen Einzelheiten über bestimmte Sperren.
Sperrunterlagen sind
-Sperrpläne
-Sperrhefte
-Minenmeldungen
-Minensperrnachweise
Sperrverband
Gefechtsverband, in dem Teile von Kampftruppen, Artillerie und Pioniere
beweglich bereitgehalten werden, um überraschende Feindvorstöße schnell
abriegeln zu können.
Spitzenzug
Vorderster Zug einer Vorhut, er ist meist verstärkt.
Sprengkommando
Kräfte, die eine Sprengung technisch vorbereiten.
Sprengsicherungskommando
Kräfte, vornehmlich der Kampftruppe, welche die Vorbereitung und Auslösung
einer Sprengung sichern. Das Sprengsicherungskommando untersteht dem für die
Sprengung verantwortlichen Führer.
Staffel
Eine Grundform der Entfaltung. Ein Zug entfaltet sich zur „Staffel links“
oder „Staffel rechts“, wenn er sowohl nach vorn als auch in eine Flanke
beobachten und wirken soll.

Ständige Sperre
Im Rahmen des Baus von Befestigungslinien errichtete Sperre, die mit ihrer
Fertigstellung wirksam ist. Ständige Sperren können sein
-Hangabstiche / Steilwandsperren
-Panzergräben (trocken oder wassergefüllt)
-Tetraeder-Sperren
Ständige Sperren können im Rahmen von Armierung weiter ausgebaut und
verdichtet werden, z.B. durch Anlage weiterer Minen- und Drahtsperren, Flutung
trockener Panzergräben, Anstauungen.
Stellung
1. Stelle, von der aus
-der einzelne Soldat mit seiner Waffe
-die Bedienung einer Waffe
-die Besatzung eines Kampffahrzeugs
gegen Sicht und Feuer möglichst gedeckt den Feuerkampf führt.
Man unterscheidet
-teilgedeckte
-versteckte und
-offene Stellungen
2. Geländeteil, der den Kampftruppen zugewiesen wird und in dem sie – ggf.
unter Ausnutzung der eigenen Beweglichkeit den Feuerkampf hauptsächlich in eine
Richtung führen.
stören
Feuerauftrag / Feueranforderung: Den Feind beunruhigen, in seinen Handlungen
behindern und dabei möglichst schädigen.
Störminensperre
Ohne Schema meist verdeckt angelegte Minensperre, die Bewegungen des Feindes
verlangsamen, ihn verwirren und daran hindern soll, einen bestimmten Raum ungestört
zu benutzen. Ihre Lage muß auf die Operationen der Kampftruppen abgestimmt
sein, sie braucht jedoch nicht verteidigt, gesichert oder mit beobachtetem Feuer
überwacht zu werden.
Stoßtrupp
Besonders gegliederte Kräfte für einen bis ins einzelne vorbereiteten, straff
geführten Angriff und meist durch schwere Waffen und Pioniere unterstützten
Angriff mit engbegrenzten Ziel gegen Feind in ausgebauten Stellungen, vor allem
im Orts- oder Waldkampf.
Straßenbelegungszeit
1. Zeit, die eine Marschkolonne braucht, um einen Straßenabschnitt zu
durchfahren und wieder freizumachen.
2. Zeitraum, für den einen Truppenteil eine Marschstraße – zumeist in einer
Richtung – vorrangig zugeteilt wird; zugleich Sperrzeit für andere Märsche.
Durch Zuteilen von Straßenbelegungszeiten lassen sich Märsche zeitlich
aufeinander abstimmen.
Straßendienst
Maßnahmen, die die Leistungsfähigkeit von Straßen erhalten oder
wiederherstellen sollen. Umfaßt das Unterhalten und das Instandsetzen von Straßen,
sowie den Straßen-Winterdienst.
Taktik
Lehre von der Führung der Truppen und deren Zusammenwirken im Gefecht sowie die
Anwendung dieser Lehre. Sie umfaßt alle Führungsgebiete und gilt auf allen Führungsgebieten.
Taktische Unterstellung (einsatzmäßige Unterstellung)
Sie umfaßt den operativen und taktischen Einsatz eines Verbandes sowie die
Unterstellung hinsichtlich der laufenden Versorgung, wenn über diese nichts
anders angeordnet ist.
Die Unterstellung eines Verbandes in allen übrigen Angelegenheiten wird
hierdurch nicht berührt. Die taktische Unterstellung kann für die Dauer oder
auch zeitlich bzw. für eine bestimmte Aufgabe begrenzt sein.
Teileinheit
Untergliederung einer Einheit (Kompanie, Batterie) in Züge, Gruppen, Trupps.
Teileinheiten können auch selbständig sein (z.B. Krankenkraftwagenzug).
teilgedeckte Stellung
Stellungsart, bei der die Geländeform oder eine Feldbefestigung Soldaten,
Kampffahrzeuge oder schwere Waffen weitgehend Schutz vor Flachfeuer und
teilweise auch vor Splitterwirkung bietet.
Territoriale Unterstellung
Sie umfaßt die Unterstellung hinsichtlich Standortfragen, Angelegenheiten von
Presse, Rundfunk, Wehrpropaganda usw., Fürsorge- und Versorgungsfragen (sofern
nicht abweichend geregelt), Abwehrfragen, Fragen der Wehrwirtschaft und
Raumordnung, Wehrersatzwesen, ärztliche und veterinärärztliche territoriale
Maßnahmen, Verteilung der Unterkünfte, Wehrmachtstransportwesen,
Wehrmachtnachrichtenwesen, Kriegsgräberwesen, Seelsorge, Einsätze bei Notständen,
Bekämpfung eines im Territorialbereich luft- oder seegelandeten Feindes, militärischer
Ordnungsdienst und Straßenverkehrsleitung, Verkehr mit Behörden außerhalb der
Wehrmacht.
Truppendienstliche Unterstellung
Sie umfaßt Dienstbetrieb, Ausbildung (soweit nicht eine gesonderte
Unterstellung befohlen), Erziehung, Disziplinarwesen, Betreuung, Personalwesen,
jedoch NICHT die taktische Unterstellung.
Truppeneinteilung
Von der Grundgliederung abweichende Zusammensetzung von Truppen für einen
bestimmten Zweck (z.B. Gefechtsverband, Stoßtrupp).
Dabei können Einheiten und Verbände verstärkt, vermindert oder gemischt
werden.
Truppenfernmeldedienst
Tätigkeiten von Soldaten aller Truppengattungen zum Herstellen, Halten und
Unterhalten von Fernmelde- (Nachrichten-) Verbindungen, die nicht zum Bereich
der Fernmeldetruppe gehören.
Übergangsleistung
Leistung einer Übergangsstelle für den Uferwechsel in einer bestimmten Zeit in
einer Richtung, gemessen an der Zahl der Personen, an der Art und Zahl der
Fahrzeuge oder bei Fähren in der Nutzlast in Tonnen.
Die Übergangsleistung hängt ab von
-der Lage, vor allem der Luftlage
-der Zahl und Art von Übergangsmitteln und Übergangsmöglichkeiten
-den Zu- und Abfahrtswegen am Gewässer
-den Gewässer- und Uferverhältnissen, sowie von Wetter u. Jahreszeit (Eisgang,
Hochwasser, Sturm)
Übergangsmittel
Mittel, mit denen Gewässer unabhängig von ständigen Übergangsmöglichkeiten
überwunden werden können.
Leichte Übergangsmittel sind Schlauchboote, Sturmboote, Stege und Behelfsübergangsmittel.
Weitere Übergangsmittel sind
-Kriegsbrücken und Fähren
-Behelfsbrücken
Übergangsmöglichkeiten, ständige
Brücken, ortsgebundene Fähren und Furten, die bei normaler Wasserführung ständig
benutzt werden können.
Eisenbahnbrücken, Staudämme, Schleusen und Wehre lassen sich oft schon nach
geringer Vorbereitung zum Übergang nutzen.
Übergangsplan
Plan zur räumlichen und zeitlichen Regelung des Uferwechsels von Truppen.
Der Übergangsplan enthält vor allem
-Übergangsstellen und Ausweichübergangsstellen mit Zu- und Abfahrtswegen
-die Aufteilung der Pionierkräfte mit ihren Übergangsmitteln
-die Truppeneinteilung, die Reihenfolge und den zeitlichen Ablauf für den Übergang
-die Maßnahmen zum Schutz des Übergangs.
Übergangsstelle
Stelle an einem Gewässer, an der die Truppe den Uferwechsel und Ausnutzung ständiger
Übergangsmöglichkeiten oder mit Hilfe von Übergangsmitteln durchführt.
überwachen
1. Allgemein
Ein bestimmtes Objekt, einen Raum oder Tätigkeiten und Verhalten von Kräften
beobachten oder kontrollieren, um erforderliche Maßnahmen treffen zu können.
2. Feuerauftrag / Feueranforderung
Einen bestimmten Raum beobachten und bereit sein, einen Feind, sobald er
auftritt, mit beobachtetem Feuer zu bekämpfen.
3. Fernmeldewesen
Fernmeldeverkehr mithören, überprüfen und ggf. aufzeichnen, um festzustellen,
ob die Bestimmungen für die Abwicklung und den Schutz des Fernmeldeverkehrs
eingehalten werden.
Uhrzeigerverfahren
Verfahren zur Richtungsangabe, vor allem bei gepanzerten Kampftruppen und der
Flugabwehr.
Der Mittelpunkt eines gedachten Zifferblattes liegt dort, von wo aus eine
Richtung gegeben werden soll (z.B. Stellung eines Luftraumbeobachters).
Die „12“ des Zifferblattes zeigt
-bei Kraftfahrzeugen in Fahrt und im Halten auf Bugmitte
-bei Flugabwehrgeschützen ist Stellung nach Norden.
Umfassung
Operation mit dem Ziel, Feindkräfte von ihren Verbindungen abzuschneiden oder
sie einzuschließen.
Dies kann durch Angriff in die tiefe Flanke oder den Rücken des Feindes
geschehen; aber auch Bewegungen feindlicher Kräfte in die Tiefe des eigenen
Raumes lassen sich zur Umfassung ausnutzen.

unmittelbare Feuerunterstützung
Art des Feuerkampfes der Artillerie.
Durch unmittelbare Feuerunterstützung ermöglicht oder erleichtert die
Artillerie den Verbänden der Kampftruppen ihre Aufträge auszuführen. Das
Feuer richtet sich zeitlich und örtlich nach ihren Forderungen und nach den
Ergebnissen der artilleristischen Aufklärung. Die Ziele liegen überwiegend im
Verantwortungsbereich der Kampftruppen.
Unterstellung
Sammelbegriff für Truppen, Kommandobehörden und
Dienststellen, die einer höheren Dienststelle in jeder Hinsicht unterstellt
sind.
Verantwortungsbereich
Teil des Kriegsschauplatzes in dem ein Kommandeur verantwortlich führt.
Er umfaßt den innerhalb zugewiesener Grenzen und vorwärts der vorderen eigenen
Kampftruppen liegenden Raum, in welcher der Verband für die Aufklärung
verantwortlich ist und in dem er mit dem Feuer der ihn zur Verfügung stehenden
Waffen wirken kann.
à Interessenbereich
Verbindungsorgane
Ständig oder zeitweilig zu einem Stab / Gefechtsstand tretende Soldaten oder
Kommandos, die den Austausch von Informationen zu gewährleisten haben.
Verbindungsorgane sind z.B.
-Verbindungsoffiziere
-Verbindungskommandos
-Melder und Kuriere
-Ordonnanzoffiziere
-Spähtrupps
Verfolgung
Operation, bei der eine Truppe einen in seiner Widerstandskraft erschütterten
und weichenden Feind nachdrängt, um ihn nicht zur Ruhe kommen zu lassen und ihn
vollständig zu schlagen. Dazu können besondere Verfolgungsverbände gebildet
werden.
Verkehrsart
1. Fernmeldewesen
Diejenige Art, in der Fernmeldeverkehr – gerätetechnisch bedingt oder auf
Befehl – nach zeitlicher Reihenfolge und/oder nach Richtung abgewickelt wird.
Es werden unterschieden
-Richtungsverkehr
-Wechselverkehr
-Gegenverkehr
2. Verkehrsführung / Transportdurchführung
Sammelbegriff, um den Gesamtverkehr nach dem Verkehrsweg zu unterteilen. Es
werden unterschieden
-Straßenverkehr
-Eisenbahnverkehr
-Binnenwasserverkehr
-Seeverkehr
-Luftverkehr.
Verkehrsform
Betriebliche Form der Verkehrsbeziehungen von Fernmeldestellen untereinander.
Verkehrsformen sind z.B.
-Kreisverkehr / Netzverkehr: Alle Funkstellen können direkt mit jeder anderen
Funkstelle im Funkkreis in
Verbindung treten.
-Linienverkehr: Funkverkehr zwischen zwei Funkstellen auf einer diesen
vorbehaltenen Frequenz
-Sternverkehr: Mehrere Funkstellen können direkt mit einer Zentralstelle in
Verbindung treten, können
aber keine Verbindung untereinander
aufnehmen.
vernichten
Allgemein oder als Feuerauftrag/Feueranforderung: Dem Feind solche Verluste zufügen,
daß er für den weiteren Kampf ausfällt. Das Vernichten erfolgt durch mehrere
Feuerüberfälle möglichst zahlreicher Batterien. Zum Erzielen der nötigen
Feuerdichte sind für einen Feuerüberfall etwa 48 Schuß s.F.H. oder 72 Schuß
l.F.H. oder 60 Schuß 10 cm Kanone erforderlich. Entscheidend für die Wirkung
ist neben guter Lage des Feuers die Kürze der Zeit, in der die vorstehende
Munitionsmenge in das Ziel gebracht wird.
Verteidigung
Gefechtsart, in der eine Truppe einen Raum gegen Angriffe des Feindes hält,
indem sie den Angreifer durch Feuer, Sperren und Gegenangriffe zum Stehen bringt
und dabei möglichst starke Feindkräfte zerschlägt.
Die Verteidigung wird aus einem Hauptkampffeld geführt, das nach vorne durch
die Hauptkampflinie (HKL) begrenzt wird. Die HKL muß bei Abschluß der Kämpfe
wieder in eigener Hand sein. Im Hauptkampffeld gliedert sich die Infanterie nach
der Tiefe und kämpft aus schachbrettartig angelegten Stützpunkten und
Widerstandsnester, die sich gegenseitig mit Feuer unterstützen können.
Vor dem Hauptkampffeld liegen bei Bedarf vorgeschobene Stellungen und
Gefechtsvorposten, die der Besatzung des Hauptkampffeldes Zeit verschaffen, sich
abwehrbereit zu machen und die den Feind zum vorzeitigen Entfalten seiner Kräfte
zwingen sollen.
Breiten in der Verteidigung:
Infanterie-Bataillon: 800 bis 2000 m
Infanterie-Division: 8000 bis 10.000 m.
Verwüstung
Großflächiges Hindernis als Folge der Zerstörung der Geländebedeckungen /
bebauter Gebiete, vor allem durch Brände, langandauernden Beschuß oder
Naturkatastrophen.
Verzögerung
Gefechtsart, in der eine Truppe bei einem feindlichen Angriff unter Preisgabe
von Raum Zeit gewinnt, indem sie das Vordringen des Angreifers in häufigem
Wechsel der Gefechtsarten verlangsamt und seine Kräfte abnutzt.
Der Begriff Verzögerung erscheint in den Vorschriften der Wehrmacht nicht, in
der Praxis stellte jedoch die Gefechtsart „hinhaltender Widerstand“ und auch
die beweglich geführte Verteidigung, wie sie aus Kräfte- und Materialmangel ab
1943 vor allem an der Ostfront häufig geworden war, nichts anderes als eine
Verzögerungsoperation dar.
Verzögerungslinie (VZL)
Führungslinie zur räumlichen und zeitlichen Regelung von Operationen im Verzögerungsgefecht.
Verzögerungslinien werden quer zur vermuteten Angriffsrichtung des Feindes in
Geländeabschnitten festgelegt, die der Truppe den Zusammenhalt der Operationsführung
erleichtern, ihr aber auch Rückhalt für eine zeitlich begrenzte Verteidigung
bieten können. Sie sollen im Gelände auch bei Nacht leicht auffindbar sein.
Vorausangriff
Von Teilen der Angriffskräfte meist mit nahem Ziel geführter Angriff mit dem
Zweck, den Angriff der Hauptkräfte zu erleichtern oder für ihn die
Voraussetzungen zu schaffen. Vorausangriffen können z.B. dazu dienen, Schlüsselgelände
oder Brücken überraschend wegzunehmen.

Vorausverband
Gefechtsverband, der den Hauptkräften vorausgeworfen wird, um zum Beispiel ein
Schlüsselgelände schnell in Besitz zu nehmen.

Vorbefehl
Befehl, mit dem ein militärischer Führer den Empfänger frühzeitig neue Aufträge
bekanntgibt, noch ehe die eigene Planung oder Befehlsgebung abgeschlossen ist.
Mit dem Vorbefehl kann der Führer auch Vorbereitungen, z.B. das Herstellen der
Marschbereitschaft oder den Ansatz von Erkundung und Aufklärung veranlassen.
Vorgeschobener Beobachter
Beobachter der Artillerie und der schweren Infanteriewaffen, der die Kampftruppe
begleitet, das Feuer zu ihrer unmittelbaren Unterstützung lenkt und die
Gefechtsaufklärung der Truppe verdichtet.
Vorhut
Kräfte zur Sicherung einer Marschkolonne nach vorn.
Die Vorhut kann eine verstärkte Kompanie umfassen. Ihr werden nach je nach Lage
Teile anderer Kampftruppen, Beobachter der Artillerie und Pioniere zugeteilt.
Der Spitzenzug ist Teil der Vorhut.
Eine als Vorhut eingesetzte Infanteriekompanie gliedert sich in
-Reiter- oder Radfahrerspitze (1 Gruppe, ca. 1 km voraus)
-Infanteriespitze (eine oder zwei Gruppen)
-1 Pak
-Masse der Vorhutkompanie, dabei 1 Gruppe schwere Granatwerfer (2 Werfer), 1
Gruppe s.MG, Teile
des Infanterie-Pionierzuges des
Regiments.

Wagenhalteplatz
Sanitätseinrichtung, etwa auf Höhe der Regimentsgefechtsstände oder an
Marschstraßen, in der Krankentransportraum zur Unterstützung der Truppe und
zur Weiterleitung Verwundeter in Sanitätseinrichtungen bereitgehalten wird.
Wagenhalteplätze werden im Divisionsgebiet meist durch die Krankenkraftwagenzüge
der Division besetzt.
Wirkungsschießen
Nach Stärke und Dauer auf die Gegebenheiten und die Eigenart des Zieles
abgestimmtes Feuer.
zerschlagen
Allgemein oder als Feuerauftrag/Feueranforderung: Die Kampfkraft des Feindes so
herabsetzen, daß er für eine begrenzte Zeit nicht mehr am Kampf teilnehmen
oder zumindest seine Absicht nicht mehr ausführen kann.
zerstören
Allgemein oder als Feuerauftrag/Feueranforderung: Unbrauchbarmachen von
Material, Anlagen, Einrichtungen und Bauten aller Art. Zum Zerstören einer
feindlichen Batterie sind mindestens 240 Schuß l.F.H. oder 160 Schuß s.F.H.
erforderlich.
Zündbereitschaft
Bezeichnung für den Stand der Vorbereitung einer Sprengung. Man unterscheidet:
-Zündbereitschaft 1: Sprengladungen sind gegen vorzeitige Zündung gesichert.
-Zündbereitschaft 2: Sprengladungen können jederzeit gezündet werden.
Zwischenraum
Entfernung zwischen Personen, Fahrzeugen oder Truppen nach den Seiten,
gemessen in Längeneinheiten.
Zwischenziel (ZZ)
Der einer Truppe befohlene Raum, den sie auf dem Weg zu ihrem Angriffsziel zunächst
nehmen soll. Auf jeder Führungsebene können ein oder mehrere Zwischenziele
befohlen werden, um die Bewegungen der Angriffstruppen räumlich und zeitlich
aufeinander abzustimmen und mit dem Feuer der Unterstützungswaffen in Einklang
zu bringen.

Literatur:
-Altrichter, Friedrich: Der Reserveoffizier. Berlin 1940.
-Cochenhausen, v.: Taktisches Handbuch für den Truppenführer und seine
Gehilfen. Berlin 1939.
-Greiner, Heinz: Taktische Aufgaben im Regimentsverband. Berlin 1938.
-Greiner / Degener: Aufgabenstellung und Übungsleitung mit praktischen
Beispielen. Berlin 1938.
-Greiner / Degener: Taktik im Rahmen des verstärkten
Infanteriebataillons. Berlin 1941
-Greiner / Degener: Gefechtsführung und Kampftechnik.
Berlin 1937.
-Heeresleitung – Truppenamt: H.Dv 300/1 Truppenführung
(T.F.) Teil I. Ausgaben 1933, 1936, 1943.
-Heeresleitung – Truppenamt: H.Dv 300/1 Truppenführung
(T.F.) Teil II. Ausgaben 1936, 1943.
-o.V.: Angriff – Verzögerung – Verteidigung (Truppenpraxis, Beiheft 1/1987)
-Uebe, K. W.: Das verstärkte Bataillon. Führungsgrundlagen und
Befehlsbeispiele. Berlin 1938
-Volkmann, H. / Fangohr, F.-J.: Befehlstechnik. Winke und Anregungen für ihre
Anwendung im Rahmen
der Division und des verstärkten
Regiments. Berlin 1938.
Oberkommando des Heeres (OKH):
-H.Dv.g. 6/6. Handbuch f. Transportdienststellen. 1939
-H.Dv.g. 66. Richtlinien
für die Führung und den Einsatz der Panzer-Division. Ausgaben 1940, 1942.
-H.Dv.g. 80. Richtlinien für die Führung und den Einsatz der
Infanterie-Division (mot). 1941.
-H.Dv. 90. Versorgung des Feldheeres (V.d.F.) - Teil 1. Ausgaben 1935, 1940.
-H.Dv.g. 90. Versorgung des Feldheeres (V.d.F.) Teil 2
(Zahlenangaben). Ausgaben 1938, 1942.
-H.Dv. 92 g.Kdos - Handbuch für den Generalstabsdienst im Kriege. 1939.
-H.Dv. 130/9. Ausbildungsvorschrift für die Infanterie (A. V. I.) Heft 9 Führung
und Kampf der Infanterie.
Das
Infanterie-Bataillon. 1940.
-H.Dv. 130/9b. Ausbildungsvorschrift für die Infanterie (A. V. I.) Heft
9b Vorläufige Richtlinien für Einsatz
und Führung des
Infanterie-Bataillons (mot). 1941.
-H.Dv. 130/19. Ausbildungsvorschrift für die Infanterie (A. V. I.) Heft 19
Versorgung im Grenadier-
Regiment. 1945.
- H.Dv. 130/20. Ausbildungsvorschrift für die Infanterie (A. V. I.) Heft 20 Die
Führung des Grenadier-
Regiments. 1945
-H.Dv. 220/9. Ausbildungsvorschrift für die Pioniere (A.V.Pi.) Teil 9 -
Gliederung, Stärke und Ausstattung
der Pioniere und Truppenpioniere.
1940.
-H.Dv 483.Die Nachschubdienste/-truppen des Feldheeres. Ausgaben 1939, 1943.
-Merkblatt g 10/17. Marsch- und Verkehrsregelung (gültig für alle Waffen) (OKH/Genst.
des Heeres/Ausb.
Abt. /Ia) Nr. 2600/40 g). 1940.
-Merkblatt 18 b/37. Alarmeinheiten. 1944
© Jörg Wurdack, Mai 2004.